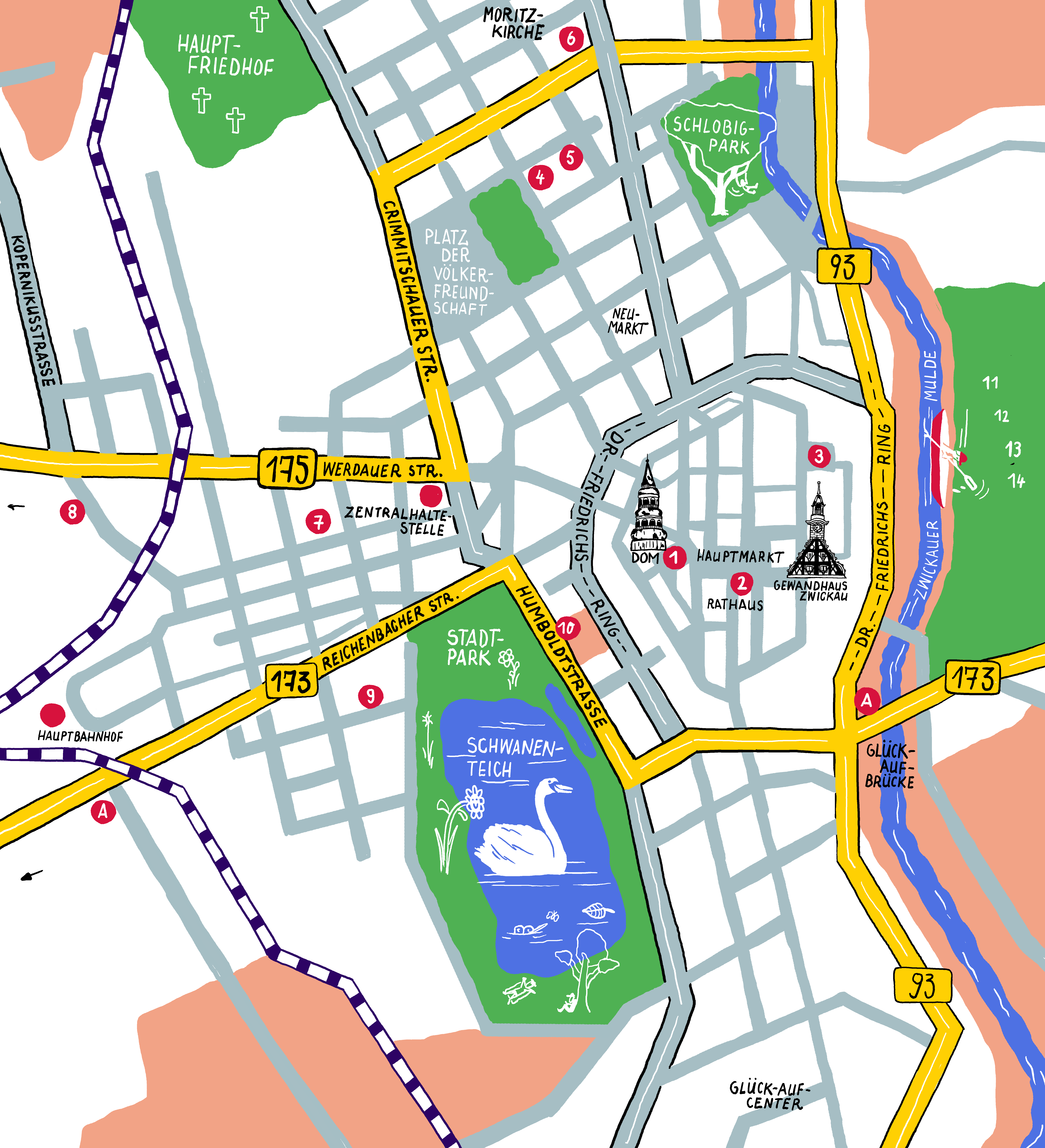25 Jahre – 25 Menschen – 25 Geschichten
Anlässlich des Zwickauer Bürgerfests ‚25 Jahre Deutsche Einheit‘ am 3. Oktober 2015 entstand im Verein ALTER GASOMETER die Idee, sich gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen eines medienpädagogischen Projekts auf Spurensuche zu begeben. Welche Erinnerungen haben Menschen aus der Region an die Wendezeit 1989/90, wie veränderten sich ihre Lebenspläne, wie erlebten sie den gesellschaftlichen Umbruch, denken sie noch in den Kategorien ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘? Oder warum entschieden sie sich bewusst für ein Leben in den neuen Bundesländern? Und schließlich die Frage, wie vereint ist unser Land im Jahr 2015?
25 Zeitzeugeninterviews wurden mit Menschen aus Ost und West und dem europäischen Ausland geführt. In einem kreativen Prozess entstanden 25 Geschichten, die junge Menschen in Form einer Ausstellung aufbereiteten. Sie schrieben Texte, machten Porträtaufnahmen und produzierten kurze Videos. Für die einzelnen Teilbereiche des Multimediaprojekts standen den Teilnehmern eine Journalistin, ein Fotograf, der Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanal Zwickau (SAEK Zwickau) sowie die Pädagogen vom Jugendbereich des ALTEN GASOMETERS zur Seite.
Andreas Bacher
JAHRGANG 1958 – GEBURTSORT DIPPOLDIWALDE- WOHNORT ZWICKAU – MUSIKPÄDAGOGE & MUSIKER
Die Liebe zur Musik begleitet Andreas Bacher schon ein ganzes Leben lang. Dass er als Saxofonlehrer am Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau mit dieser Leidenschaft im wiedervereinten Deutschland auch sein Leben finanzieren kann, macht ihn nach eigener Aussage zu einem glücklichen Mann. Wohlbehütet aufgewachsen in Zwickau-Marienthal wurde er schon früh an die Musik herangeführt. Während seiner Elektriker-Lehre spielte er in der Berufsschule in seiner ersten Band und in seiner Armeezeit in Berlin lernte er Thomas Richter kennen, den heutigen Leiter der Zwickauer Musikschule.
Die Wendezeit erlebte Andreas Bacher als Zick-Zack-Kurs: Studium, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, befristete Stellen als Musikpädagoge. „Dann hieß es: Wir haben kein Geld für Kultur. Da fiel ich erstmal durch’s Rost.“ Also wieder arbeitslos und zurück in den alten Job. Doch schließlich konnte er den Elektriker-Beruf endgültig an den Nagel hängen, sich ganz auf die Musik konzentrieren und sogar zwischen zwei Musikschulen wählen.
Den Mauerfall erlebte Andreas Bacher vorm Fernseher und konnte es zunächst nicht glauben. „Wir waren neugierig, was da drüben so alles ist und dann hat man gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser“, beschreibt er seine Erinnerungen an seinen ersten West-Besuch in Kronach. Die anfängliche Euphorie sei bei ihm schnell abgeebbt. Sätze wie „Lernt erstmal zu arbeiten“ klingen ihm noch heute in den Ohren.
Eine Flucht aus der DDR stand für den heimatverbundenen Crimmitschauer nie zur Debatte, obwohl sich ihm 1989 eine einmalige Chance geboten hatte: Er war gerade mit seiner Frau und der frisch geborenen Tochter in Ungarn als hunderte DDR-Bürger auch die bundesdeutsche Botschaft in Budapest besetzten. Doch er wollte nicht alles wegwerfen, zudem sei es ihnen in der DDR recht gut gegangen. „Wir hatten nichts auszustehen und haben die negativen Seiten im Alltag nicht gespürt – oder vielleicht wollten wir sie auch nicht wahrhaben.“
Insgesamt sieht Andreas Bacher 25 Jahre deutsche Einheit positiv: „Alles was marode war, hat sich nach außen hin zum Guten gewendet,“ lobt er die vielen Sanierungen sowie das neue Stadt- und Kulturbild. Die Meinungsfreiheit begreift er als großes Plus der Wiedervereinigung. Doch bis die Ostdeutschen auch vom letzten nicht mehr als „Deutsche zweiter Klasse“ behandelt werden, wird es seiner Meinung nach weitere ein bis zwei Generationen brauchen.
Bei der Frage, ob er sein heutiges Leben gegen ein Leben in der DDR tauschen würde, ist er ein wenig hin- und hergerissen. Finanziell betrachtet geht es ihm heute zwar etwas besser, doch sei vieles deutlich teurer und im Verhältnis daher für viele nicht erreichbar. „Reisefreiheit will auch finanziert sein.“ Zudem hat seine Frau mit dem Aufkommen der Supermärkte ihren kleinen Lebensmittelladen aufgeben müssen. Durch ihren 400-Euro-Job kennt sie inzwischen auch die Schattenseiten der neuen Wirtschaftsordnung.
In der Erinnerung spielt die DDR daher für Andreas Bacher noch immer eine Rolle, wenn auch ohne Verklärung. Doch sein Leben in der DDR war Kindheit und Jugend. „Da erinnert man sich gern zurück.“ Was ihm heute fehlt, ist die soziale Sicherheit, die Überschaubarkeit im Alltag und ein gewisser Anstand, den er in seiner Kindheit noch anders erfahren hat.
Andreas Voigt
JAHRGANG 1957 – GEBURTS-UND WOHNORT ZWICKAU – VERANSTALTER BEI LIEDERBUCH E.V.
Andreas Voigt wuchs in einer christlichen Familie auf. Die Jugendweihe lehnten er und seine Brüder als Gelöbnis auf den sozialistischen Staat ab. Auch der FDJ tritt der gebürtige Zwickauer nicht bei. In der Schulzeit, bei der Berufswahl und auf der Arbeitsstelle als Werkzeugmacher erlebt er eine Aneinanderreihung von Schikanen. So erhält Andreas Voigt beispielsweise keine Prämie, weil er nicht in der Gewerkschaft ist, auch seine ganze Abteilung geht wegen des „Staatsfeindes“ leer aus. Lebenspläne traut sich Andreas Voigt nicht zu machen, ohnehin ist seiner Ansicht nach im DDR-Staat alles vorgezeichnet.
Alles was er möchte, ist eine glückliche Familie. Und schon das ist schwer genug, noch 1989 lebt das frisch verheiratete Paar bei seiner Mutter. Der Urlaub wird zum Highlight des Jahres und penibel geplant, denn er denkt nicht einmal daran, dass sich die Grenzen für ihn je öffnen könnten. Dennoch ist er ein lebensfroher Mensch, erträgt vieles mit Humor. Umso einschneidender ist für Andreas Voigt der Mauerfall. Zum einen ist er froh, dass die Revolution friedlich abläuft angesichts der Studentenproteste in Peking und deren blutiger Niederschlagung.
Zum anderen erlebt er die Wende als spannende Zeit, in der die Bürger Politik mitgestalten können. Der ersten Euphorie folgt jedoch die schnelle Ernüchterung. „Diese Träume, die da entstanden, dass man selbst das Land verändern kann, das wurde mit der schnellen Wiedervereinigung at acta gelegt“, sagt er rückblickend. Der politische Apparat der BRD hat sehr zügig das Ruder übernommen, die DDR-Opposition war im Meinungswettstreit unterlegen, das bedauert er noch heute. Über die Deutsche Einheit als solche ist er jedoch froh. Die neuen Zeiten bringen für Andreas Voigt zwar auch viel Unsicherheit mit sich, letzten Endes lebt er heute aber seinen Traumberuf.
Als Geschäftsführer des Liederbuch e.V. organisiert er hauptberuflich Konzerte, hat mit Menschen aus aller Welt zu tun. Die Veranstaltungsreihe wird 1985 von ihm mit ins Leben gerufen. Damals treten im Lutherkeller im Schutz der Kirche vor allem kritische Musiker auf, es ist eine Anlaufstelle für Andersdenkende. Hier nimmt 1989 die erste Zwickauer Montagsdemo ihren Anfang. 25 Jahre später ist Andreas Voigt der Ansicht, dass Deutschland schon ganz gut vereint ist, aber in jedem großen Land gibt es Unterschiede. „Ich bin zufrieden und freue mich in einem wohlhabenden Land zu wohnen, wir gehören zu den reichsten Menschen dieser Erde. Denn in anderen Ländern herrscht Krieg, Hunger oder Armut. Wir leben in einem gut versorgten Sozialstaat, in unserem Land muss keiner unter den Tisch fallen und darüber bin ich sehr froh.“
Auch wenn es Kleinigkeiten gibt, die seiner Meinung nach zu DDR-Zeiten effizienter waren – er nennt Polikliniken oder das gemeinsame Lernen bis zur 8. Klasse als Beispiel – sehnt sich Andreas Voigt nicht einen Moment zurück. „Manchmal, wenn im Fernsehen Berichte kommen über die DDR-Zeit, dann sagen wir, Gott sei Dank, das ist vorbei und unsere Kinder können in freiheitlicheren Verhältnissen aufwachsen.“ Gerade die Meinungsfreiheit will er nicht missen.
Persönlich wird er zu DDR-Zeiten zwar nie direkt von der Stasi drangsaliert, aber dass der Staat immer mithört, ist ihm klar. „Ich weiß von Freunden, das Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, ohne deren Wissen.“ So kennt er eine Geschichte, wonach die Nachbarin den Zweitschlüssel aushändigte, um nach vermeintlich belastbarem Material zu suchen. Andreas Voigt liest seine Stasi-Akte nach der Wende und erfährt so unter anderem, dass seine Familie auch von Freunden bespitzelt wurde. „Im Nachhinein muss ich sagen, ist es gut, dass mir nichts Schlimmeres wiederfahren ist.“
Heute sieht er vor allem regionale Mentalitäten und Unterschiede zwischen Ost und West. In der Politik hingegen wird seiner Ansicht nach häufig noch aus einer westdeutschen Perspektive heraus gedacht. Ein Beispiel sind die Hartz IV-Gesetze, die im Osten Deutschlands zu deutlich größeren Verwerfungen geführt haben.
Barbara Gabor
JAHRGANG 1963 – GEBURTSORT CRIMMITSCHAU – WOHNORT CRIMMITSCHAU – MITINHABERIN DES CAFÉS ‚CARPE DIEM‘
Als Jugendliche entdeckt Barbara Gabor ihr Interesse für Medizin, als sie vor und nach der Schule ihre demente Großmutter pflegt. Das Abitur und somit ein Studium bleibt ihr trotz guter Zensuren im sozialistischen Staat verwehrt: Ihr Elternhaus ist katholisch und politisch nicht aktiv. So wird sie Krankenschwester, doch noch heute wurmen sie diese verlorene Chance und der Gedanke, dass andere mit schlechteren Noten studieren und Arzt werden konnten. Damit steht Barbara Gabor innerlich schon frühzeitig in Opposition zur DDR. „Man konnte sich nicht so entfalten, wie man wollte“, blickt sie zurück.
Nach einem Besuch zu einem runden Geburtstag bei der Westverwandtschaft in Köln 1988, für den sie als „Pfand“ jedoch ihre Kinder zuhause lassen musste, kommt ihr die DDR grau und trostlos vor. Es war weniger der Wohlstand, der sie beeindruckte, sondern vor allem die bunte Vielfalt und die Offenheit der Menschen. Von da an sieht Barbara Gabor in der Heimat vieles noch kritischer, ist nun nicht mehr nur in der Kirche, sondern auch in oppositionellen Gruppen engagiert.
Und schließlich wird aus dem Widerstand aktiver Veränderungswille, als die Einschulung ihres Kindes näher rückt. Sie und ihr Mann wollen ihre Kinder nicht im DDR-Schulsystem aufwachsen sehen. Doch im Gegensatz zu vielen Freunden, die aus der DDR flüchteten, entscheiden sich die Gabors bewusst für’s Bleiben. „Wir haben gesagt: Nein, wir bleiben hier. Wir wollen hier etwas verändern, hier ist unser Zuhause, hier sind wir geboren, wir kämpfen dafür. Bringt nichts, wenn die DDR ausblutet.“
Also organisiert Barbara Gabor Friedensgebete, gründet mit anderen Mitstreitern über das Königswalder Friedensseminar in Crimmitschau das Neue Forum – und bekommt die Macht der Stasi zu spüren. Sie fühlt sich beobachtet, nachdem sie bei Friedensgebeten ihre Telefonnummer angegeben hatte, wird ihr Telefon abgestellt. „Obermieter von uns hatten einen kleinen Hund, die waren dann abends noch draußen, mit dem Hund Gassi gehen. Irgendwann haben sie mal geklingelt und haben gesagt: Wisst ihr, dass immer abends der gleiche Lada vor der Tür steht?“
Ein beklemmendes Gefühl, erinnert sie sich. Man musste immer auf der Hut sein, genau überlegen was man laut sagt oder lieber nur denkt. Dass die Revolution am Ende eine friedliche war, darüber ist die Stadträtin und ehrenamtliche Bürgermeisterin heute noch froh. Und nach 25 Jahren Wiedervereinigung sieht sie mit Ausnahme der Löhne nur noch wenige Unterschiede. „Es ist sagenhaft, was sich in den 25 Jahres alles entwickelt hat.“
Vom Mauerfall selbst erfuhr Barbara Gabor per Telefon nachts um 2 Uhr von ihrem Mann, der gerade in der Bundesrepublik war. Gleich am nächsten Morgen wollte sie auch in den Westen fahren, doch das Benzin war alle und die Züge zu überfüllt, um mit zwei Kindern zu reisen. Also brauchte Barbara ihre Kleinen zu den Großeltern und reiste allein nach Stuttgart, wo sie mit offenen Armen empfangen wurde. Und trotzdem hatte sie in dem Moment das Gefühl, am falschen Ort zu sein, als sie im Fernsehen die Menschen auf der Berliner Mauer tanzen sah. „Ich saß heulend vorm Fernseher, ich dachte du hast irgendwo einen Punkt Geschichte an dem Abend verpasst.“
Inzwischen denkt Barbara Gabor nur noch selten an die DDR zurück. Sie ist froh, dass sie diese Zeit hinter sich lassen kann. Allein der Gedanke daran, wie sie notdürftig bei Freunden oder in Geschäften oder über die Firma ihres Mannes Papier zusammengekratzt hätten, um Flugblätter vervielfältigen zu können – wo man heute Papier an jeder Ecke bekommt. Oder die Machenschaften der Stasi: Aus der Stasiakte ihrer Mutter gehen zum Beispiel Dinge hervor, die nur über ein Richtmikrofon hätten abgehört werden können. „Das ist im Nachhinein schockierend.“
Dass es ehemalige Zuträger der Stasi heute noch nicht schaffen, sich öffentlich zu bekennen, ärgert sie. Zumal es Menschen gegeben hat, die Ehen auseinandergebracht oder die eigene Familie bespitzelt haben und dann mit ihrem Stasi-Zubrot auch noch besser lebten als der Durchschnitt. Noch heute sitzt im Crimmitschauer Stadtrat ein ehemaliger IM. Für ihn zündet die Stadträtin Barbara Gabor bei jeder Sitzung eine Kerze an, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Hier hätte sie sich mehr Aufarbeitung gewünscht.
Auch wenn sie nicht mehr in ihrem Beruf als Krankenschwester arbeitet, sondern sich zwischenzeitlich um die Buchhaltung ihres Mannes gekümmert hat und heute ein Café in Crimmitschau betreibt, möchte sie ihr altes Leben auf keinen Fall zurück. „Der Mensch ist mehr gefordert, man hat so viele Möglichkeiten – man muss eigentlich die Chance nutzen und sagen gut, ich mache es einfach.“ Würde es die DDR noch geben, hätte sie wahrscheinlich keine Flucht in Erwägung gezogen, aber „mit Sicherheit“ die Ausreise beantragt.
Constance Arndt
JAHRGANG 1977 – GEBURTSORT DRESDEN – WOHNORT ZWICKAU – FILIALLEITERIN MODEHAUS WÖHRL PLAUEN
Constance Arndt ist eine engagierte Frau mit klaren Aussagen. Ihr beruflicher Werdegang führt die gebürtige Dresdnerin von der Landeshauptstadt nach Zwickau, wo sie heute als Stadträtin aktiv ist. Von der Auszubildenden im Einzelhandel hat sie sich bis zur Filialleiterin hochgearbeitet, zunächst im Modehaus Wöhrl in Zwickau, inzwischen arbeitet sie in Plauen.
Aufgewachsen ist die Mutter einer Tochter in einem Neubaugebiet in Dresden-Gorbitz. Mit der DDR-Zeit, die sie in erster Linie als Kind erlebt hat, verbindet sie etliche Erinnerungen. So kommen zu Beginn ihrer Schulzeit wöchentlich neue Kinder in die Klasse, bis die Schule aus allen Nähten platzt und sie sogar wechseln muss. Auch die tollen Westpakete von Tante und Geschwistern der Oma sind ihr im Gedächtnis geblieben. „Das große Highlight, wenn das Nutella-Glas kam und das Drama, wenn es kaputt gegangen ist und man versucht hat, ob man nicht an diesen Scherben noch das Nutella abkratzen kann, um es zu retten.“
Doch auch die Wendezeit, damals war Constance Arndt etwa zwölf Jahre alt, ist noch präsent. Eines Abends fährt sie im Auto mit ihren Eltern in Dresden zufällig mitten in eine Demo hinein. „Da habe ich das erst Mal erlebt, hier verändert sich was“, erinnert sie sich an ihre Gedanken. Den Tag des Mauerfalls selbst kann sie nicht mehr im Detail beschreiben, doch die Veränderungen, die damit einher- gehen. Denn nun sind die Klassen in ihrer Schule fast leer. „Es gab mal einen Tag, da waren wir zu zehnt von über 20 in der Klasse, weil die eben mal schnell in den Westen rübergefahren sind.“
Ihrer Meinung nach sind die Wende und die deutsche Wiedervereinigung historisch einzigartig. Die Ostdeutschen haben ihre Zukunft selbst in die Hand genommen, diese „Lücke der Geschichte“ genutzt. Auch aus diesem Grund war und ist die Zwickauer Stadträtin immer stolz auf ihre Herkunft gewesen, geht damit selbstbewusst um und spielt eher mit dem Klischee vom Ossi, so zum Beispiel als sie zwei Jahre lang in Bayreuth gearbeitet hat. 25 Jahre nach der Deutschen Einheit hat sich ihrer Einschätzung nach bereits sehr viel verändert, die Lebensläufe zwischen Ost und West haben sich gut vermischt.
Was ihr jedoch gerade angesichts des Jubiläums große Sorgen bereitet, ist die fehlende Toleranz und Selbstkritik – vor allem auf Seiten der ehemaligen DDR-Bürger. „Wenn ich mir überlege, wie viele Ostdeutsche aus weitaus weniger wichtigen Gründen aus der DDR geflüchtet sind.“ Statt immer nur an sich selbst zu denken, sollten wir menschlich sein, Verständnis zeigen und etwas abgeben, von dem was wir haben.
Als ehrenamtlich tätige Kommunalpolitikerin, die in Zwickau viel Potenzial sieht, treibt sie auch die immer geringer werdende Wahlbeteiligung um – und findet deutliche Worte: „Für das Recht zu wählen sind Menschen auf die Straße gegangen, haben gekämpft dafür und heute wird mir das viel zu schnell damit abgetan, dass der Einzelne sagt, ich kann eh nichts ändern. Das verurteile ich.“
25 Jahre nach der Wiedervereinigung – und es sind laut Constance Arndt eben gerade einmal 25 Jahre – geht es auch im Osten vielen Menschen so gut, dass sie satt und bequem geworden sind. Doch als Bürger in einer Demokratie haben wir ihrer Ansicht nach nicht nur Rechte sondern auch Pflichten. „Das kommt mir im vereinten Deutschland zu kurz.“
Bernd Aschenborn
JAHRGANG 1944 – GEBURTSORT ZWICKAU – WOHNORT ZWICKAU – RENTNER
Bernd Aschenborn ist mit Leib und Seele Sportler. Bereits seit seiner Kindheit ist er als Skilangläufer bei Lok Zwickau aktiv und nimmt an zahlreichen Wettkämpfen teil. Doch irgendwann will er auf Strecken jenseits der Grenze laufen. So nutzt er diverse Familienfeiern der Westverwandtschaft, um sich außerhalb der DDR sportlich zu messen.
An einen Visumsantrag erinnert sich der Rentner noch wie heute: Als seine Cousine ein Kind bekommt, sieht er endlich die Chance am Wasa-Lauf in Schweden teilzunehmen und sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Da sei der „Genosse Hauptmann“ laut geworden und habe ihn gefragt, was er sich erlauben würde ins „kapitalistische Ausland“ reisen zu wollen. Über Umwege kann Bernd Aschenborn den 90 Kilometer langen Skilauf letztendlich antreten – 1989 noch als einziger DDR-Bürger.
Beruflich hat es Bernd Aschenborn weniger leicht als im Sport. Als „Kapitalistensohn“ darf er zunächst kein Abitur machen, wird stattdessen Maschinenschlosser, muss sich mit vielen Repressalien der örtlichen Parteispitze auseinandersetzen. Wirkliche Pläne hat er ohnehin nicht. Der Staat habe seine Bürger geführt und Mitarbeiter delegiert, eigene Wünsche und Vorstellungen seien zweitrangig gewesen. 1972 wird zudem der Betrieb seiner Familie enteignet. So sind er und sein Bruder plötzlich arbeitslos und angesichts seiner Parteilosigkeit ist es schwierig eine neue, angemessene Stelle zu finden.
Die Wende ist für ihn ein schleichender Prozess, er erlebt sie nicht wie viele andere im Rauschzustand. Obwohl er sich nie an vorderster Front beteiligt – die Stasi bescheinigt ihm trotzdem aktenkundig eine „negative Einstellung zur DDR“ – ist er ab der ersten Minute bei Friedensgebeten und Montagsdemos dabei.
Vom Mauerfall erfährt er während einer Sitzung im Klubhaus Sachsenring. „Und jeder fragte nun, hast du gehört? Was soll man denn davon halten und wie entwickelt sich das. Und als ich dann nach Hause kam, waren schon die Bilder da – da kriegt man gleich wieder Gänsehaut – was sich da am Brandenburger Tor abspielte.“
Genau diese Gänsehaut hatte er auch vor 25 Jahren, als er an seinem ersten Berlin-Marathon teilnahm und durch das offene Tor laufen durfte. „Das kann man nicht schildern, was das innerlich für mich bedeutet hat.“ Es ist dieses umfassende Freiheitsgefühl, was Bernd Aschenborn wohl am meisten mit der Wiedervereinigung verbindet. Das Land ist dabei zusammenzuwachsen – ein Prozess, der seine Zeit braucht. Sein Rezept gegen Mauern im Kopf: Reisen. Von Grönland und Skandinavien über New York bis Kamtschatka, ob Osterinseln oder Antarktis: Er ist schon auf der ganzen Welt Marathon gelaufen und Ski gefahren. „Diese Freiheit möchte ich nicht missen.“
Wenn es die DDR noch gäbe, wäre er wahrscheinlich ein unbeachtetes Glied in der Kette der DDR-Bürger, die das System durchschaut hatten und überzeugt waren, dass Sozialismus auch nicht das ist, was es zu sein schien. Zwar hat Bernd Aschenborn trotz eines Studiums zum Wirtschaftsingenieur nach der Wende keine Karriere gemacht, aber nach eigener Aussage immer das Beste aus allem herausgeholt. Zuletzt unterstützte er seine Frau, eine niedergelassene Ärztin, in ihrer Praxis.
Zurückhaben möchte er den sozialistischen Staat daher auf keinen Fall. Man hat so heute so viele Freiheiten auf allen Gebieten. Jeder hat die Möglichkeit, das zu machen, wozu er Lust hat ohne dass an jeder Ecke ein Polizist steht oder man vom Nachbar angezinkt oder gar von der Stasi kontrolliert wird, sagt Bernd Aschenborn. Die Wiedervereinigung sieht er daher uneingeschränkt positiv, auch wenn die Demokratie nicht nur gute Seiten hat.
Missen möchte er all seine Erfahrungen aber auch nicht. „Wir sind froh, dass wir das erleben durften, diese Wende. Manchmal sind wir sogar glücklich, dass wir erst die DDR-Verhältnisse kannten. Umso mehr schätzen wir jetzt den Wohlstand, in dem wir doch leben.“ Denn den meisten Deutschen geht es seiner Meinung nach sehr gut. Das wird ihm immer wieder bewusst, wenn er dieser Tage Flüchtlinge sieht. Diese Menschen kommen mit wenigen Taschen, während wir alles doppelt und dreifach haben und in der eigenen Wohnung gar nicht mehr wissen, wohin mit diesen Dingen.
Daniel Friedrich
LEHRER FÜR ENGLISCH UND ETHIK
Daniel Friedrich hat die Liebe nach Sachsen verschlagen – die zu seiner Freundin und seinem Beruf. Nach dem Abschluss seines Lehramtsstudiums in Mainz steht ihm der Weg nach West und Ost offen: Werdau in Sachsen oder Trier in Rheinland-Pfalz werden dem Lehrer für sein Referendariat angeboten. Da seine aus Hamburg stammende Freundin bereits eine Referendarstelle in Leipzig angetreten hat, ist die Entscheidung schnell getroffen. Die Reaktionen seiner Familie und seiner Freunde fallen gemischt aus.
Die meisten reagieren mit Verständnis, da sie es gewohnt sind, dass Daniel Friedrich sich ausprobiert, auch jenseits der (bundes-)deutschen Grenzen. So war er bereits während seines Studiums in Spanien und Irland. Andere hingegen sind überrascht. „Für die ist Sachsen natürlich auch noch so ein bisschen ein unbekanntes Land. Macht der nochmal ein Auslandsjahr – ja, das war so ein bisschen die Denke.“
Aufgrund seines Alters hat er den Mauerfall und die Wendezeit nicht bewusst erlebt. Als einzige Erinnerung hat sich die Fußballweltmeisterschaft 1990 eingeprägt. Dennoch bewertet er insbesondere die friedliche Revolution als Glücksfall. Die deutsche Geschichte ist aus seiner Sicht eine schöne Geschichte, denn dass sich zwei feindlich gegenüberstehende Systeme einander wieder annähern, ist nicht selbstverständlich. Das hat ihn seine Zeit in Irland gelehrt, wo er immer wieder auf die deutsche Wiedervereinigung angesprochen wurde. „Die Iren finden es spannend, dass das bei uns friedlich abgelaufen ist.“
Große Unterschiede im Alltag kann er nach 25 Jahren Deutscher Einheit nicht mehr ausmachen. Fußgängerzonen ähneln sich, die Menschen hören die gleiche Musik. Nur beim Bier stellt der gebürtige Eifeler Unterschiede fest: Positive allerdings, denn der Osten hat nach seinem Empfinden mehr regionale Sorten zu bieten.
In der Kategorie Ossi oder Wessi denkt er nicht. Zwar wird er aufgrund seines Hochdeutschs hin und wieder auf seine Herkunft angesprochen, doch mit Vorurteilen zu kämpfen hatte er bislang nie. Im Gegenteil: Die Leute reagieren eher überrascht, dass er „freiwillig“ hierher gekommen ist. Er fühlt sich im Osten gut aufgenommen und mag die „sächsische Schnauze“, sprich die Direktheit der Menschen hier, die er aber nicht als unhöflich sondern als ehrlich empfindet. An eine Rückkehr in die alten Bundesländer um des Westens willen hat er noch nie gedacht. Nur von den rhein- hessischen Weinbergen rings um seine Studienstadt Mainz träumt er hin und wieder mit einem Glas Wein in der Hand.
Denis Toth
JAHRGANG 1970 – GEBURTSORT ZWICKAU – WOHNORT ZWICKAU – TÄTIG IN DER LUKASWERKSTATT ZWICKAU
Denis Toth hat eine schöne Kindheit und Jugend: Trotz seiner Behinderung, er sitzt bereits sein ganzes Leben im Rollstuhl, absolviert er eine Ausbildung zum Teilgeräte-Montierer im Zwickauer Sachsenring-Werk und montiert dort bis zur Wende Kleinteile für Trabbis. „Für mich war der 9. November das Beste, was mir in meinem Leben bis jetzt passieren konnte“, sagt er ungeachtet dessen mit einem Strahlen im Gesicht.
Denn Denis Toth hatte schon immer auf die Grenzöffnung gehofft. Jeden Tag veränderte sich etwas und damit letztlich alles, erinnert er sich zurück an die Zeit kurz nach dem Mauerfall. Man konnte nun alles ansehen, alles kaufen und auch überall hinreisen. Diese Chance nutzte Denis Toth schon mehr als einmal: Er hat bereits London, Rom, New York und viele andere Städte dieser Welt gesehen. Jedoch haben sich aus seiner Sicht im Vergleich zur DDR manche Dinge auch verschlechtert. Früher, so sagt er, hat er einfach einen neuen Rollstuhl bekommen, wenn er ihn brauchte. Heute müsse er dafür Anträge schreiben, alles offenlegen und quasi nachweisen, dass er dieses Hilfsmittel unbedingt benötigt.
Zudem hatten behinderte Menschen in der ehemaligen DDR die Alternative, in normalen Betrieben zu arbeiten. Heute bezahlen die Unternehmen seiner Meinung nach lieber die Ausgleichsabgabe, als einen Menschen mit Behinderung einzustellen. So haben er und auch viele andere keine andere Wahl, als in einer Behindertenwerkstatt zu arbeiten, wobei sie im Vergleich zu früher aber deutlich weniger verdienen. Denis Toth empfindet es zudem als diskriminierend, dass seine Berufsausbildung heute nicht anerkannt wird. Denn die unzähligen neuen beruflichen Möglichkeiten hätten den Rollstuhlfahrer trotz seiner Behinderung gereizt, nutzen konnte er sie allerdings nicht.
Entmutigen lässt sich Denis Toth davon jedoch nicht, er sucht sein Glück in anderen Dingen und bewertet die Freiheit für alle als höheres Gut als seine persönlichen Nachteile. 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung besteht seiner Ansicht nach noch viel Nachholbedarf, besonders in der Wirtschaft. „Es wird die gleiche Arbeit gemacht für weniger Geld. Ich finde es sehr schade, dass die Kluft noch so groß ist und nach 25 Jahren hat sich da nicht viel getan.“ Denis Toth glaubt nicht daran, dass er die volle Angleichung der Löhne noch erleben wird. Nichtsdestotrotz ist er ein lebensfroher Mensch, der vor allem eines nach dem Ende der DDR genießt: seine Freiheit.
Frank Maier
JAHRGANG 1956 – GEBURTSORT REICHENBACH – WOHNORT WERDAU – POLIZEIHAUPTKOMMISSAR
Mit 29 Jahren beschließt Frank Maier für die damalige DDR-Zeit etwas recht Ungewöhnliches: Er will noch einmal etwas ganz anderes machen und geht Mitte der 80er zur Polizei, wird Abschnittsbevollmächtiger. Als ABV ist er für die Gemeinde Blankenhain zuständig und in den Wirren der Wendezeit auch für die Absicherung mancher Montagsdemonstration in Werdau oder Crimmitschau.
Er gehört zu den Männern, die 1989 DDR-Bürger davon abhalten sollen, auf die Züge aufzuspringen, die aus Tschechien mit Botschaftsflüchtlingen Richtung Bundesrepublik fahren. Auch erinnert er sich an einen Einsatz am Bogendreieck in Ruppertsgrün, von dem ihm berichtet wurde. Im Nachhinein gingen viele der an diesem Einsatz beteiligten Polizisten in die Kirche, um sich für ihr Handeln zu entschuldigen.
Für ihn selbst und für viele Kollegen ist es damals schwierig zu wissen, wie sie sich verhalten sollen. In dem einen Moment ist es ihre Aufgabe, im Nachhinein gelten sie als Unterstützer des niedergehenden Staates. Bis zur Wiedervereinigung im Oktober 1990 bewegt sich der Polizist, der nun kein Volkspolizist mehr ist, sondern der Landespolizei Sachsen angehört, in einer rechtlichen Grauzone. „Was an dem einen Tag richtig war, war an dem anderen Tag auf einmal falsch. Und man hat ja davor gedacht, man macht es auch richtig“, sagt Frank Maier, der inzwischen ein Kommissariat leitet, nachdem er mit 40 nochmal studiert hat.
Direkt nach der Wende überlegt er, ob er wirklich weiter als Polizist arbeiten kann und will. Als ehemaliger ABV muss er sich einer Stasi-Prüfung unterziehen. Da er nie Kontakt zur Stasi hatte, bleibt er im Dienst. Im Nachhinein möchte er sein jetziges Leben nicht gegen sein Leben in der DDR eintauschen, es geht ihm heute gut und er ist zufrieden.
Er hat jedoch auch in der DDR ein glückliches Leben geführt, keine negativen Erfahrungen gemacht. „Das möchte ich im Nachhinein nicht beschönigen oder verschweigen.“ Frank Maier war vom Staat überzeugt, sonst wäre er nicht zur Polizei gegangen. Vor allem aber ist es ihm in seinem Beruf wichtig, Menschen zu helfen und das kann er jetzt genauso wie vor 25 Jahren, denn die grundlegenden polizeilichen Aufgaben unterscheiden sich wenig.
Die deutsche Wiedervereinigung bewertet er positiv, genießt heute vor allem die Reisefreiheit – und die Tatsache, dass er seine Verwandten im Westen Deutschlands jederzeit besuchen kann. Denn zu DDR-Zeiten musste er als Polizist unterschreiben, dass er keinerlei Kontakt zu ihnen hat. Treffen waren nur heimlich möglich, wenn seine Angehörigen in der DDR zu Besuch waren.
Als Volkspolizist war Frank Maier ein treuer Diener des Staates, hat das System nicht hinterfragt. Wäre die Staatssicherheit auf ihn zugekommen, hätte er Auskunft gegeben und auch geben müssen. „Was alles war, das hat man nicht gewusst, so ehrlich muss ich einfach sein. Das klingt zwar blauäugig im Nachhinein, aber es war halt so“, meint er rückblickend. Zumindest musste er zu DDR-Zeiten nie mit Schlagstock gegen Demonstranten vorgehen, da alle Demos, bei denen er eingesetzt war, friedlich verliefen.
Jens Weise
JAHRGANG 1959 – GEBURTSORT ZWICKAU – WOHNORT ZWICKAU – FREIBERUFLICHER MUSIKER
Sein ganzes Leben wollte er nur eins: Musik machen. Jens Weise, der sich seinen Traum erst recht spät erfüllte, ist heute freiberuflicher Musiker. Der Weg dahin war kein gerader, viele Umwege ist der Zwickauer gegangen. Seit seinem vierzehnten Lebensjahr steht er auf der Bühne, spielt seine Lieder. „Das war schon immer mein Leben, mein Bestreben und meine Freude vor allen Dingen.“
Da er aber nie sein Geld hätte damit verdienen können, richtet er eben den Broterwerb an der Musik aus. Weil es der gelernte Maurer von seiner Arbeitsstelle in Plauen nicht immer zur Bandprobe nach Zwickau schafft, sucht er sich kurzerhand einen neuen Job. Nach längerer Krankheit muss er sich allerdings erneut umorientieren: Doch eine Ausbildung zum Energetiker, einen Beruf, den es so nur in der DDR-Planwirtschaft geben konnte, bricht er ab, holt lieber sein Abitur nach und versucht es an der Ingenieurschule. Da kommt die Wendezeit und alles wird anders.
Doch Jens Weise sieht all das Erlebte durchweg positiv, denn es hat ihn immer wieder für seine Musik inspiriert. Kritische Texte schreibt der Liedermacher schon zu DDR-Zeiten, ist aber nicht in vorderster Front dabei. Vor allem über Freunde erfährt er, was zum Beispiel in Leipzig bei den Montagsdemonstrationen vor sich geht. Auf Arbeit gibt es „heiße Diskussionen“, erinnert er sich. „Es wurden Flugblätter verteilt, wo gesagt wurde, steck‘ die in die Hosentasche und geh‘ aufs Klo und lies sie da, weil die Stasi halt überall war.“ Das hat er einmal auch am eigenen Leib erfahren, als er von der Bühne geholt wurde.
Dennoch hat er über eine Flucht nie ernsthaft nachgedacht. „Für mich war es nicht die Frage zu gehen, sondern eher die Frage etwas zu bewegen.“ Mit seiner Musik will er in seiner Heimat etwas verändern, zudem die Familie nicht im Stich lassen. Umso größer ist die Freude über den unverhofft plötzlichen Mauerfall, den er vorm Fernseher erlebt. „Wir haben gedacht, das gibt es nicht, jetzt plötzlich fällt die Mauer und das ist eigentlich nicht wahr.“
Ohne diese Wende hätte es auch die Wende in seinem Leben nicht gegeben, ist er überzeugt. „Das was ich wollte, habe ich erreicht. Das wäre in der DDR nicht machbar gewesen, nämlich Musiker zu werden.“ Jens Weise findet die Wiedervereinigung uneingeschränkt positiv, auch wenn 80 Millionen Menschen immer eine gewisse Herausforderung darstellen. „Diese Freiheit, die jetzt herrscht – und natürlich ist die immer an gesellschaftliche Normen gebunden – die ist toll!“
Für ihn persönlich bedeutet diese Freiheit, seine Lieder singen, seiner inneren Berufung nachgehen zu können. Auch wenn sich seine Musik zwangsläufig ebenso verändert hat wie das Land. Denn aufgrund der Zensur mussten die DDR-Musiker mehr in Bildern sprechen, wenn sie Kritisches äußern wollten. Heute kann er direkter und derber formulieren, versucht aber sich diesen Stil zu bewahren. Ebenso wie das kritische Nachdenken über die Welt in seinen Liedern.
Auch möchte er sein Leben in der DDR nicht abhaken, denn dort hat er schließlich die Hälfte seines Lebens verbracht. „Das kann man nicht wegdenken und das wäre auch falsch.“ Es ist seine Vergangenheit, sein Ich. Statt die Erinnerungen zu verdrängen, sollte man sie lieber gebrauchen. Das Klischeedenken in Ost und West findet er daher auch unsinnig, beide Seiten haben ihre Erfahrungen, die gilt es einzubringen. Es ist seiner Ansicht nach niemals leicht, das zu tun was man tun möchte – ganz gleich in welcher Gesellschaft man lebt.
Klaus Fischer
JAHRGANG 1957 – GEBURTSORT TÜBINGEN/BADEN-WÜRTTEMBERG – WOHNORT REINSDORF – KUNSTHÄNDLER UND KUNSTVERMITTLER
Klaus Fischer hat die Liebe in den Osten verschlagen. Dass er am Ende zum „Ossi“ wird und in Zwickau landet, steht jedenfalls nicht auf seinem Lebensplan. Geboren in Tübingen spielt der zweite deutsche Staat in seinem Leben bis zur Wende keinerlei Rolle. Als Student der Germanistik, Philosophie und Anglistik beobachtet er mit seinen Kommilitonen 1989 über die Medien, was sich im Ostblock abspielt. Als er vom Mauerfall hört, ist er gerade bei Freunden zum Essen eingeladen. Bis 4 Uhr früh sitzt er dann mit seiner Mutter, die er extra aus dem Bett holt, vor dem Fernseher. „Tief bewegt“, wie er sich erinnert.
14 Tage später fährt Klaus Fischer nach Berlin, wo er gerade eine Kunstgalerie eröffnen will. Obwohl die Grenzen offen sind, muss er Kontrollen über sich ergehen lassen, steht schließlich zum ersten Mal im Ostteil der Stadt – und ist geschockt. „Ich dachte, oh du meine Güte, was ist in diesen vielen Jahren DDR kaputt gegangen an Häusern oder an Bausubstanz. Also das fand ich sehr, sehr auffällig.“
Mitte der 90er lernt er seine Lebenspartnerin kennen, die damals bereits in den heutigen Kunstsammlungen Zwickau arbeitet und ihre Stelle nicht aufgeben will. Nach einigen Jahren Fernbeziehung zieht er endgültig von Berlin nach Zwickau, in den „Süden“ sozusagen. Hier engagiert er sich als Vorsitzender des Kunstvereins Freunde aktueller Kunst e.V. Nach rund 20 Jahren an der Mulde hat er „räumliche Heimatgefühle“ entwickelt, denn die Landschaft erinnert ihn an seine schwäbischen Wurzeln.
Eine Rückkehr in den Westen hält er für ausgeschlossen. Es hat alles seine Zeit und Tübingen oder Berlin sind in seinem Leben Geschichte. Inzwischen ist er wohl eher ein Ossi, auch wenn er diese Unterscheidung nur noch als Scherz gebraucht. Seiner Ansicht nach gibt es nach wie vor ein Ungleichgewicht zwischen Ost- und Westdeutschen, was die Zurkenntnisnahme des anderen Landesteils anbelangt.
Die Wiedervereinigung beurteilt Klaus Fischer im großen historischen Kontext betrachtet als unvermeidlich. Seiner Meinung nach ist der Gedanke eines gemeinsamen Europas mit Deutschland in seiner jetzigen Rolle irreversibel. Das einst getrennte Land erkennt man heute nur noch an unterschiedlichen Gehältern – und Abendeinladungen. „Ich bin noch nicht dahinter gekommen, ist das nun sächsisch oder ostdeutsch, dass Abendeinladungen schon so gegen 6 Uhr beginnen. Das kenne ich aus dem Westen überhaupt nicht. Da geht das ab 8 los und nicht um 6. Das ist vielleicht der wichtigste Unterschied zwischen Ost und West heute“, sagt er mit einem Augenzwinkern.
Auch in der professionellen Kunstszene kann Klaus Fischer 25 Jahre nach der Wiedervereinigung kaum noch bedeutende Unterschiede ausmachen. In der DDR gab es seiner Einschätzung nach nur punktuell abstrakte Kunst, stattdessen war der Realismus sehr angesagt. In Westdeutschland hingegen gab es alle Spielarten, da die Kunst nicht reglementiert wurde. Nach der Wende hätten sich beide Seiten künstlerisch betrachtet schnell angenähert. Was Klaus Fischer zufolge von der DDR-Prägung übrig geblieben ist, bewertet er positiv: Zum einen werde im Osten noch mehr Wert auf das Handwerk gelegt, zum anderen ist die grafische Kunst, wie Holz- und Linolschnitte oder Radierungen, hier noch präsenter und auf einem sehr hohen Niveau.
Michael Petzold
JAHRGANG 1963 – GEBURTSORT STOLLBERG – WOHNORT HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – ELEKTRIKER
Mit Mitte zwanzig geht Michael Petzold zur Nationalen Volksarmee, wo er auch die Wendezeit erlebt. Was ihm besonders in Erinnerung geblieben ist: Der Polit-Unterricht verändert sich in dieser Zeit ganz plötzlich. „Verbrechen gab es in der DDR nie, das ist immer tot geschwiegen worden“, sagt er. Doch dann kommen Offiziere zu ihm und seinen Kameraden und erzählen ihnen von eben solchen Verbrechen und von ihrer Zeit in der Sowjetunion. Auf einmal wird deutlich, dass das große Vorbild Kratzer hat und sich schließlich sogar als das komplette Gegenteil entpuppt.
„Und dann hieß es plötzlich: Die Mauer ist offen und schließlich durften auch die Armee-Angehörigen in den Westen“, erklärt Michael Petzold heute. Doch als diese Nachricht bei ihm ankommt, fährt er nicht wie so viele andere sofort los. Stattdessen verbringt er seinen Urlaub zu Hause. Auch die euphorischen Berichte von West-Besuchen können nichts daran ändern, dass der Elektriker sich vor allem Sorgen macht, die negativen Folgen wie beispielsweise den Verlust von Arbeitsplätzen fürchtet.
In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung fühlt sich Michael Petzold denn auch als „Spielball“. Er arbeitet in ganz Deutschland auf Montage, wie so viele. 14 Tage unterwegs, zwei Tage zu Hause. „Da haben sie immer zu dir gesagt, da stehen hundert andere, die warten auf deinen Job. Da musstest du das Spiel mitmachen nach der Wende.“ Das hat sich nach seiner Einschätzung inzwischen aber gebessert.
Eintauschen möchte Michael Petzold sein Leben dennoch nicht, allerdings vermisst er heute vor allem die soziale Sicherheit. Insbesondere Menschen, die nicht die besten mentalen Voraussetzungen mitbringen, können seiner Meinung nach schlechter mithalten und haben es im vereinten Deutschland schwerer bei der Arbeitssuche. Bezogen auf sich selbst sagt er, dass es ihm zu DDR-Zeiten nicht schlecht ging und auch heute nicht schlecht geht.
Rückblickend hat sich direkt nach der Wende bei vielen Ostdeutschen jedoch „alles nur um das Materielle gedreht.“ Wahllos wurden West-Produkte gekauft, diese ausschließlich für toll gehalten und das neue Auto war Gesprächsthema Nummer Eins. Eine Mauer im Kopf hat Michael Petzold heute nicht mehr, er ist trotz aller Erfahrungen froh über die Wiedervereinigung. Wirklich vereint ist das Land aus seiner Sicht aber 25 Jahre später noch nicht. Dass es immer noch so große Unterschiede bei den Löhnen gibt, zeigt den Nachholbedarf.
Stefan Kolev
JAHRGANG 1981 – GEBURTSORT SOFIA – WOHNORT ZWICKAU – PROFESSOR FÜR VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE AN DER WHZ
Stefan Kolev kann sich noch genau daran erinnern, dass er am 9. November 1989 bei seinen Großeltern war. Denn sein Großvater sagte mit Blick auf den Fernseher „Ach, in Berlin tut sich etwas“. Am Tag darauf stürzt auch das sozialistische Regime in Bulgarien in sich zusammen. Noch heute sieht sich Stefan Kolev als Kind bei einer der größten Kundgebungen in Sofia im Juni 1990 auf den Schultern seines Vaters sitzen – inmitten von einer Million Menschen.
Dass eine neue Zeit angebrochen ist, merkt er vor allem im Klassenzimmer. Stefan Kolev geht auf die Deutsche Schule in Sofia und hat Kontakt zu ost- wie westdeutschen Lehrern. Doch schnell wird deutlich, dass die alten Eliten die neuen Zeiten für sich zu nutzen wissen. „Aus den sozialistischen Funktionären der Partei und ihrer Satellitenorganisationen wurden einfach kapitalistische Unternehmer.“ In diesem System will er nicht leben. Kaum hat er mit 18 Jahren sein deutsches Abitur in der Tasche, geht er nach Hamburg.
Dort kann der gebürtige Bulgare studieren, als Volkswirt promovieren, erhält Stipendien und verdient mitunter in der Stunde mehr als seine Eltern pro Woche in Bulgarien – als Ärzte. „Die Bundesrepublik oder Westdeutschland, wie es damals hieß, war von Bulgarien aus geradezu ein Synonym für das Paradies“, erinnert er sich. Und auch für ihn sind die zehn Jahre in Hamburg eine tolle Zeit. Er wird sehr gut aufgenommen, fühlt sich nur in ganz wenigen Situationen als Ausländer. Als es ihn beruflich in den Osten verschlägt, zunächst nach Erfurt und vor drei Jahren nach Zwickau, bedauern ihn Freunde und Familie für den „Rückschritt“, den er selbst jedoch nicht als solchen empfindet.
Die Distanz ist seinem Empfinden nach aber größer, wenn die Menschen am Akzent merken, dass er kein Sachse ist. Diese Unterschiede in der Mentalität, diesen Umgang mit dem „Anders sein“ führt der Professor der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf die unterschiedliche Sozialisation zurück.
In einem Forschungsprojekt beschäftigt er sich mit der DDR-Planwirtschaft. Während der Westen schon lange mit permanenten Veränderungen im Wirtschaftsalltag lebt, neigen ehemalige DDR-Bürger eher dazu, Neues als Bedrohung wahrzunehmen. Dabei kann der Osten stolz auf sich sein: Die deutsche Wiedervereinigung ist nach Meinung von Stefan Kolev eine große Erfolgsgeschichte, auch wenn immer wieder Fehler gemacht wurden. Den neuen Bundesländern ist erspart geblieben, was Ländern wie Bulgarien passiert ist: Dass die alten Eliten unter neuen Vorzeichen einfach weiter machen wie bisher.
Ostdeutschland betrachtet Stefan Kolev als „Paradebeispiel für eine Schocktherapie“: Innerhalb von wenigen Monaten wurde das Land komplett umgekrempelt. Das ist nicht ohne Probleme abgelaufen, aber im Gegensatz dazu hat sich in seiner Heimat vieles überhaupt nicht verändert. 25 Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sitzen oft dieselben Menschen und Netzwerke in Machtpositionen. „Bei aller Kritik, die man an die Nachwendezeit in den neuen Bundesländern äußern muss, ist das ein Schicksal, dass der jungen Generation hier erspart geblieben ist.“
In Bulgarien sieht nach außen hin alles bunt, modern und westlich aus. Doch hinter der Fassade haben die alten Seilschaften die Wende gut überlebt, ist die Gesellschaft nach dem Aufbruch der 90er Jahre wieder eine oft geschlossene Gesellschaft, deren alte Muster Bestand haben und reproduziert werden. Wer nicht die richtigen Leute kennt, hat aus eigener Anstrengung deutlich schlechtere Karten. An eine wirkliche bulgarische Wende glaubt Stefan Kolev daher kaum, auch eine Rückkehr schließt er aus diesem Grund nahezu aus. Deshalb wandern seiner Meinung nach auch heute noch so viele Bulgaren aus – nicht nur weil ihr Land arm ist, sondern weil es ihnen nicht genügend Aufstiegschancen bietet.
Der Professor kann zwar aus psychologischen Gründen verstehen, dass sich insbesondere ältere Menschen die DDR und damit ein Stück weit ihre Jugend zurückwünschen. Doch er stellt die Behauptung auf, dass „wir in der Geschichte nie in einer freieren und besseren Welt gelebt haben.“ Das sollten wir zu schätzen wissen. Denn der verklärende Rückblick ist kein fairer Blick zurück. Es stimmt nicht, dass alle gleich waren und alle Arbeit hatten und alles so „kuschelig“ war. Die DDR war in den Augen von Stefan Kolev vor allem eines: ein Gefängnis.
Susi Rybandt
JAHRGANG 1977 – GEBURTSORT MAINZ – WOHNORT ZWICKAU – WISSENSCHAFTLICHE MITARBEITERIN AM FRAUNHOFER-INSTITUT IWU CHEMNITZ
Sie hat viel gesehen, war mal hier, mal da und dann kam Zwickau: Susi Rybandt lebt seit über zehn Jahren im Osten und fühlt sich hier mit ihrem Mann und ihrem Sohn sehr wohl. Geboren wurde sie in Mainz, wuchs in einem ländlichen Vorort auf. Nach der Lehre geht sie nach Hockenheim, arbeitet in Heidelberg als Zahnarzthelferin. Schließlich wagt sie den Schritt in die Metropole Hamburg, wo sie nach ihrem Fachabitur beginnt Medizintechnik zu studieren. Durch ein Praktikum entdeckt sie ihren wahren Traumberuf: Stahlbau-Ingenieurin.
Deutschlandweit kann man diese Spezialisierung aber nur in Mittweida studieren. Also geht sie zusammen mit ihrem Mann, der bis dato ebenfalls schon in etlichen (westdeutschen) Ecken gelebt hat, in den Osten. Und weil ihr Mann als Ingenieur einen Arbeitsplatz in Zwickau findet, landen sie schließlich in der Schumannstadt. „Wir haben hier unser Glück gefunden“, sagt sie zufrieden. „Für meinen Mann ist Zwickau der erste Ort, an dem er sich zu Hause fühlt“. Beide haben Ostbezug, wenn man so will, der vielleicht auch die Heimatgefühle erklärt. Ihre Großmutter stammt ursprünglich aus Roßwein bei Dresden, seine Familie hat ihre Wurzeln im thüringischen Altenburg.
Zudem hatte sie schon vor der Wende zwei enge Freundinnen, deren Eltern die DDR verlassen hatten. Familie und Freunde unterstützen sie und hatten nie ein Problem mit ihrem Umzug in den Osten. Für die eigenen Eltern ist es inzwischen ein Anlass, die neuen Bundesländer endlich näher kennenzulernen. Susi Rybandt lehnt das Klischeedenken in Ossi und Wessi zwar ab, vor die Wahl gestellt sieht sie sich aber eindeutig als Ossi. Wenn sie ihre Familie besucht, ist die Rede von „da drüben“.
Die Wiedervereinigung als solche bewertet sie durchweg positiv, auch wenn sie sich im Rückblick eine Kombination aus beiden gesellschaftlichen Systemen gewünscht hätte, Stichwort Kinderbetreuung und Bildungssystem. Doch 25 Jahre nach der Deutschen Einheit ist das Schubladen-Denken ihrer Ansicht nach vor allem auf Seiten der Westdeutschen noch immer stark ausgeprägt. Dann sagt sie jedes Mal: „Leute, ihr habt ja keine Ahnung.“ Zudem verkehren sich gerade die Vorzeichen und nun schimpft der Ruhrpott. In den Köpfen vieler Menschen gibt es nach Einschätzung von Susi Rybandt daher noch immer eine Mauer. „Es hat keiner geschafft in 25 Jahren aus zwei Ländern eins zu machen und ich weiß auch nicht, ob das jemals anders wird.“
Dabei ist die Ingenieurin mehr als glücklich über das Ende des Kalten Krieges, den sie in Mainz aus einer ganz anderen Perspektive erlebt hat. In ihrer Kindheit gab es dort ein Panzerwerk der Amerikaner, das damals einer der größten Arbeitgeber der Region war. Als Kinder durften sie bei Truppenübungen nicht in den Wald. War das Gebiet wieder freigegeben, fuhr sie mit ihren Freunden auf dem Fahrrad die Panzerspuren entlang, sah das Öl der Panzer in den Pfützen glitzern.
Schüsse vom Schießstand hörten sie fast täglich, sahen die mit Stacheldraht gesicherten Bunker. „Der Ort hat vor Militärfahrzeugen gewimmelt“, erinnert sie sich. Nach der Wende und dem Abzug der Amerikaner hat sich ihre Heimat verändert: Aus den Kasernen wurden Wohnhäuser, der Wald hat sich mittlerweile erholt und von den vielen KFC-Restaurants sind nur noch wenige übrig geblieben.
Thomas Synofzik
JAHRGANG 1966 – GEBURTSORT DORTMUND – WOHNORT ZWICKAU – LEITER ROBERT-SCHUMANN-HAUS ZWICKAU
„Schumann war meine große Liebe, schon als Kind“, sagt Thomas Synofzik. Dass er heute das Robert-Schumann-Haus in Zwickau leitet, verdankt er der deutschen Wiedervereinigung. Der gebürtige Dortmunder wuchs in Unna auf. Seine Eltern hatten keinerlei musikalische Ausbildung geschweige denn Neigung und doch fing der damals 5-Jährige an Klavier zu spielen. Bereits im Kindesalter hörte er die ersten Stücke von Robert Schumann und las schon mit neun Jahren die Biografie seiner Frau, Clara Wieck. Nach seinem ersten Schumann-Kongress stand für den 14-Jährigen fest, dass er Musikwissenschaftler wird.
Doch in der damals schon wichtigsten Anlaufstelle in Sachen Schumann zu arbeiten, nämlich dem Geburtshaus des romantischen Komponisten in Zwickau – das scheint für Thomas Synofzik so weit entfernt wie der Mond. Die Teilung der beiden deutschen Staaten steht dem im Wege. Zumindest überlegt er sich, wie er über den niedersächsischen Zweitwohnsitz der Eltern in einem grenznahen Gebiet einfacher an ein Visum kommen kann. Denn im dritten Semester ist dem angehenden Musikwissenschaftler klar: Er muss nach Zwickau, um zu Schumann recherchieren zu können.
Und dann fällt plötzlich die Mauer. „Als ich abends in den Radionachrichten hörte, dass die DDR die Grenzöffnung bekannt gegeben hat, das war natürlich sehr bewegend und ich habe wirklich geweint vor Freude.“ Mit 25 Jahren reist er zum ersten Mal nach Zwickau und kommt von da an alle zwei Jahre in die Robert-Schumann-Stadt. Schließlich wird er sogar Mitglied der Robert-Schumann-Gesellschaft und erhält so ein Schreiben, in dem er die Stellenausschreibung für die Leitung des Schumann-Hauses liest. Er bekommt die Stelle als einer von 25 Bewerbern und sein Lebenstraum geht in Erfüllung.
Würde die Mauer noch stehen, wäre es für ihn schwieriger gewesen seinen Traum zu leben. „Irgendwie war es vielleicht damals schon vorbestimmt, irgendwann hätte ich in den Osten gehen müssen, auch wenn die DDR geblieben wäre.“ Doch ob er diesen Schritt tatsächlich gewagt hätte – Thomas Synofzik weiß es nicht. Zudem hätte die DDR auch so offen sein müssen, einen Westdeutschen als Direktor des Hauses zu akzeptieren.
Doch nicht nur im Hinblick auf sein persönliches Schicksal schätzt Thomas Synofzik die deutsche Wiedervereinigung. Als Einheit hingegen empfindet er unser Land noch nicht. 40 Jahre hätten eine große Spaltung und eigene Wege in der Kulturpolitik bewirkt, trotz der gemeinsamen kulturellen Tradition über Jahrhunderte hinweg. Da ist seiner Ansicht nach noch viel aufzuholen. Es sind bislang noch viel mehr Menschen aus dem Osten in den Westen gegangen als umgekehrt. Hier wünscht sich der Wahl-Zwickauer eine noch deutlichere Vermischung der Lebensläufe.
Für Thomas Synofzik ist die Region das kulturelle Herz des Landes, das viel zu wenige Westdeutsche kennen. Nicht nur Schumann stammt aus dem Osten Deutschlands, auch Händel, Bach oder Schütz wurden hier geboren. Dessen ungeachtet ist er angesichts seiner Wahl-Heimat nach wie vor mit Vorurteilen konfrontiert. So wird er immer wieder gefragt, wie er freiwillig in Zwickau, sozusagen am Ende der Welt, wohnen könnte. Solche Aussagen kontert er stets gelassen: „Zwickau ist nur am Ende des Alphabets, nicht am Ende der Welt“.
Irgendwie scheint Thomas Synofzik eine besondere Beziehung zum Osten zu haben, denn schon weit vor der Wende hatte es ihm neben Robert Schumann die DDR-Rockmusik angetan. In einem Ostsee-Urlaub sieht er im DDR-Fernsehen Stern Combo Meißen und verfällt dem Sound auf Anhieb. „Die DDR-Rockmusik war sowohl musikalisch als auch textlich genial. Was da an Anspielungen drin steckt ist phänomenal, das sind lyrische Höchstleistungen, die im Westen nie zu denken gewesen wären.“
So hört er per Dachantenne DD64, das Jugendradio des sozialistischen Staates, und versucht über Freunde oder Besuche in Ost-Berlin an Platten zu kommen. Witzigerweise geht es seiner Frau genauso mit der Musik von Gerhard Schöne. Über ihre Verwandten in der DDR ordert sie „Ost-Pakete“ mit Platten und Plakaten des Liedermachers. Kathrin Synofzik stammt übrigens auch aus Dortmund, über den Weg läuft sich das Paar allerdings erst in Zwickau. Schicksal im doppelten Sinne.
Ulrich König
JAHRGANG 1946 – GEBURTSORT FREIBURG/BADEN-WÜRTTEMBERG – WOHNORT CRIMMITSCHAU – RENTNER
Viele Jahre ist Ullrich König ein „Pendler zwischen den Welten“, lebt in Köln, arbeitet jedoch im Osten. Vor zehn Jahren zieht der gebürtige Freiburger endgültig nach Crimmitschau. Mittlerweile ist er Rentner und ehrenamtlich als sächsischer Friedensrichter tätig. Dass sein Leben einmal eine solche Wendung nimmt, hätte der ehemalige Offizier der Bundesluftwaffe eher nicht gedacht.
Nach der Mittleren Reife und einer Ausbildung verpflichtet sich Ullrich König für zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Nach Beendigung seiner Laufbahn wird ihm als Offizier aus Gründen der Geheimhaltung geraten, für zehn Jahre nicht in die DDR einzureisen. Entsprechend froh ist er schließlich über den Fall der Mauer, denn als politisch interessierter Mensch möchte er gern wissen, was „auf der anderen Seite“ ist. Gleich nach der Wende macht er sich auf den Weg, um den Osten Deutschlands kennenzulernen, was ihm bis dato verwehrt war.
Ein Jahr nach der Wende liest Ullrich König, der nach seinem Abschied von der Armee in der Erwachsenenbildung tätig ist, eine Annonce für eine Stelle in Crimmitschau: „Ich habe mich dort beworben und bin mit fliegenden Fahnen gen Osten geeilt“, erinnert er sich.
In den ersten Jahren muss er als „Wessi“ im Osten vieles relativieren. In dieser Zeit büßt er ein wenig sein „Gutmensch-Denken“ und seine Euphorie ein. Es ist nicht nur der Geruch jenseits der Grenze, den er schlagartig als anders wahrnimmt, vor allem die kaputte Bausubstanz schockiert ihn. Doch was ihn wirklich erschreckt und auch rückblickend noch immer ärgert, ist die „Nimm-Mentalität“ auf Seiten der Westdeutschen. Viele wollen seiner Meinung nach zu dieser Zeit nur das große Geld mit dem Osten machen, die wenigsten hingegen erkennen damals, welche Chance sich mit der Deutschen Einheit für das Land bietet. „Es gab überhaupt keine Bereitschaft im Westen, den Osten leben zu lassen. Soll heißen: Wie die Aasgeier sind sie drüber hergefallen“, findet er deutliche Worte. Vor allem die Politik hat ihn in dieser Hinsicht schwer enttäuscht.
Ullrich König ist zwar davon überzeugt, dass es der ehemaligen DDR gut getan hat unter den „Deckmantel“ der BRD zu schlüpfen. Doch wie dieser Prozess abgelaufen ist, das kann er nicht gut heißen. Deutschland bewegt sich ganz langsam aufeinander zu, aber die noch vorhandene Trennung in vielen Bereichen wird dem Land seiner Ansicht nach noch auf die Füße fallen.
In Sachsen zum Beispiel stimmen insbesondere junge Leute mit den Füßen ab, sprich sie verlassen den Freistaat. Das trifft laut seiner Einschätzung unter anderem auf Lehrer zu, die nach ihrer Ausbildung lieber in ein anderes Bundesland gehen. Im Bildungsbereich läuft vieles katastrophal schief, doch angesichts von PISA will das niemand sehen.
Für ihn selbst ist eine Rückkehr in den Westen eher unwahrscheinlich, da er in Crimmitschau mittlerweile familiär verwurzelt ist. Dennoch fehlen ihm in Westsachsen urbane Städte mit mehr Kultur sowie einer Fülle von Leben und Lebenslust wie Köln oder Freiburg. Diese regionalen Unterschiede in der Mentalität sind für ihn wie Tag und Nacht. Wenn er sich räumlich noch einmal verändern sollte, dann würde ihn Leipzig reizen. Er ist froh darüber, dass die Unterschiede zwischen ‚Ossis‘ und ‚Wessis‘ mit jeder weiteren Generation Stück für Stück verschwinden. Mittlerweile sind zudem ostdeutsche Errungenschaften und Einflüsse in ganz Deutschland spürbar.
Ullrich König ist davon überzeugt, dass 40 Jahre Indoktrination nicht spurlos an den Menschen vorbeigehen können. Das kann er vor allem aus seiner Anfangszeit in den neuen Bundesländern bezeugen. Als er kurz nach der Wende einer Klasse mit ehemaligen NVA-Offizieren gegenüber steht und sich als Soldat der Bundesluftwaffe zu erkennen gibt, ist die Klasse auf einen Schlag gegen ihn. „Das waren systemgläubige Menschen, die mit der Wende über die Klinge springen mussten.“ Doch so als „Klassenfeind“ betrachtet zu werden, verstört ihn noch heute, erklärt im Nachhinein allerdings auch, warum ihm ein Besuch des Ostens zehn Jahre lang verwehrt war.
Thomas Walther
JAHRGANG 1961 – GEBURTSORT CRIMMITSCHAU – WOHNORT CRIMMITSCHAU – UNTERNEHMER
„Jeder ist seines Glückes Schmied.“ Dieses Zitat passt in vielerlei Hinsicht zu Thomas Walther. Denn der Crimmitschauer Unternehmer begann seine berufliche Laufbahn in der Schmiede seines Vaters, seit der Wende führt er den Betrieb. Sich nicht nur von den Umständen treiben lassen, sondern selbst aktiv werden, gilt für ihn heute wie damals.
Als „Unternehmersohn“ erlebt Thomas Walther schon als Kind die Schattenseiten des Sozialismus. Es vergeht kein Tag, an dem seine Eltern am Abendbrottisch nicht über fehlendes Material sprechen. Mit dem ständigen Mangel zurechtkommen müssen, das hat ihn geprägt, ebenso wie manche Geschichte: So erinnert er sich an einen Vortrag zu Schulzeiten über die Pleiße – damals durch die Textilindustrie einer der schmutzigsten Flüsse Europas, dem man an jedem Tag angesehen hat, welche Farbe in den Färbereien gerade verwendet wurde. Thomas Walther benennt die Missstände und wird dafür scharf kritisiert. „Das ist eines von vielen Erlebnissen, wo man gemerkt hat, dass das, was man hören wollte und was man sagen durfte, überhaupt nicht zusammen gepasst hat.“
Zudem kennt Thomas Walther durch die Westverwandtschaft das Leben hinter der Mauer. An einen zehntägigen Besuch in der Bundesrepublik erinnert er sich heute noch. Besonders die großen Läden mit einer, im Vergleich zur DDR, riesigen Auswahl beeindrucken ihn. Später sind es nicht so sehr materielle Dinge, sondern vor allem das freie Denken (und Sprechen), das ihm in der DDR fehlt.
Der Gedanke an eine Flucht kommt über die Jahre immer wieder auf. Doch der dreijährige Bau des eigenen Hauses und damit verbundene Repressalien sowie der Gedanke an die Eltern führen 1988 zu der endgültigen Entscheidung hier zu bleiben – und dafür in der Heimat politisch aktiv zu werden, zum Beispiel beim Friedensseminar in Königswalde.
Wie schnell die Mauer dann fällt, überrascht ihn. Er geht am Abend des 9. November einfach ins Bett, so fassungslos ist er. So kommt es auch, dass er mit seiner Familie erst ein paar Wochen später in den Westen fährt. Thomas Walther möchte die DDR trotzdem nicht missen. Diese Zeit hat ihn geformt und viele Erfahrungen an die Hand gegeben. „Wir mussten uns immer etwas einfallen lassen, wie wir aus dem letzten Nagel noch etwas machen können.“
25 Jahre später ist aus seiner Sicht sehr viel erreicht worden, dafür müsste man nur einmal von Ost nach West und Nord nach Süd fahren. „Es ist Wahnsinn und es ist großartig, was da geleistet wurde. Von allen, von wirklich allen.“
Wer 1990 gedacht hat, dass in Deutschland nach 10 oder 20 Jahren überall die gleichen Bedingungen herrschen, war nach seiner Meinung damals schon ein „Fantast“. Und natürlich worden auch Fehler gemacht, es wird immer etwas zu verbessern geben. Doch wenn man das Land im Großen und Ganzen betrachtet, hat die Wiedervereinigung nur Gutes gebracht. Die DDR hat vielleicht das bessere Bildungssystem gehabt, doch vieles andere wird ihm zufolge rückblickend verklärt.
So war die Armut nach Auffassung von Thomas Walther zu DDR-Zeiten größer als heute. Er kann sich noch an alte Frauen erinnern, die nicht einmal genügend Geld hatten, um ihren Handwagen neu bereifen zu lassen. Da hat sein Vater hin und wieder ausgeholfen. „Da möchte ich heute Leute sehen, denen es so schlecht geht.“
Auch den viel beschworenen Zusammenhalt zu DDR-Zeiten sieht er zwiespältig. Der hat sich oft am Bedarf definiert. Wenn beispielweise man zu einer Geburtstagsfeier Radeberger oder Wernesgrüner Bier trinken wollte, ging das nur über entsprechende Beziehungen. „Ich brauchte jemanden, den ich gut kenne. In der Not rückt man enger zusammen. In dem Sinne war das Not“, ist Thomas Walther überzeugt. Heute kauft man sich Dinge, die man braucht. Dafür geht es aber in vielerlei anderer Hinsicht nicht ohne die richtigen Beziehungen und Kontakte.
Am wiedervereinten Deutschland schätzt er vor allem die Tatsache, frei entscheiden zu können, was man tut und wer man werden will – und das jeden Tag auf’s Neue. Das sei in der DDR nicht der Fall gewesen. Sein beruflicher Erfolg gibt ihm Recht: Aus den einst drei Angestellten (sein Vater und er eingerechnet) sind inzwischen mehr als 70 geworden, das Firmengelände hat sich von 800 auf 25.000 Quadratmeter vergrößert.
Im Jahr 25 nach der Wiedervereinigung sieht er jedoch ein Gut bedroht, für das 1989 viele auf die Straße gegangen sind: die Meinungsfreiheit. Hier geht es nach seinem Empfinden wieder ein Stück rückwärts in Richtung DDR-Verhältnisse. Heute wird man zwar nicht eingesperrt, aber bei nicht konformen Äußerungen schnell in eine Ecke gestellt, ohne eine Diskussion zu zulassen.
Susanne Trauer
JAHRGANG 1962 – GEBURTSORT ROSSLAU/SACHSEN-ANHALT – WOHNORT ZWICKAU – MITBEGRÜNDERIN DES SOS-MÜTTERZENTRUMS ZWICKAU
Susanne Trauer gehörte schon vor der Wende zu den Menschen, die es als innere Dringlichkeit empfinden, etwas zu verändern und Dinge nicht einfach so hinzunehmen. Das tut sie bis heute. Schon als Halbwüchsige verwickelt sie ihre Eltern – ihre Mutter war in der Kirche, ihr Vater in der Partei – in Diskussionen über den DDR-Staat.
Nach ihrem Studium zur Puppenspielerin in Berlin verschlägt es sie nach Zwickau und hier trifft sie auf Menschen, die die DDR ebenso kritisch sehen wie sie. Ersten vertraulichen Gesprächen mit Freunden unter dem schützenden Dach der Kirche folgt bald ihr Engagement in der Bürgerbewegung. Unangenehme Erfahrungen mit der Stasi und Bespitzelung durch vermeintliche Mitstreiter inklusive.
So bringt sie zusammen mit Freunden unter anderem illegal Lebensmittel und Medikamente nach Rumänien. Während sie sich gerade auf der Rückreise von einem solchen „Abenteuer“ befindet, fällt die Mauer – und sie bekommt es zunächst gar nicht mit. Susanne Trauer wird erst um 2 Uhr nachts auf dem Dresdner Hauptbahnhof stutzig. Der ist „hell erleuchtet wie ein Palast“. Statt der üblichen Polizeikontrolle trifft sie Menschen über Menschen an. „Biste verrückt? Die Mauer ist weg!“, sagt ein Mann auf Nachfrage zu ihr. Vor lauter Schreck fährt sie erst einmal nach Hause.
Der ersten Euphorie folgen bald die große Frustration und eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allem unter Frauen. „Da hieß es: Zurück an Heim und Herd“, erinnert sich die Mutter von drei Kindern. Diesem Rollenbild will und kann sie sich nicht fügen, also geht sie zu einem zweiten Studium nach Bonn. Doch ihre erste Schwangerschaft macht ihr einen Strich durch die Rechnung und da sie das Kind zusammen mit ihrem Freund großziehen möchte, bricht sie ihre Zelte ab und kehrt zurück nach Zwickau.
Doch anstatt „bürgerliche Kleinfamilie zu spielen“ während ihr die Stadt 1990 trostlos erscheint, nimmt sich Susanne Trauer ein neues Projekt vor und gründet zusammen mit sechs weiteren jungen Müttern das SOS-Mütterzentrum. Aus den zweieinhalb Räumen des Anfangs ist inzwischen ein Mehrgenerationenhaus geworden, wie es nach ihrer Einschätzung so in der DDR niemals möglich gewesen wäre. Diese Freiheiten, diese Möglichkeiten sind es, die sie heute ganz besonders schätzt.
25 Jahre Deutsche Einheit bedeuten für Susanne Trauer aber vor allem eines: Ausruhen ist nicht. Demokratie ist aus ihrer Sicht keine Selbstverständlichkeit und kein einmal gesetzter Zustand. „Demokratie bekommt man nur für kurze Zeit geschenkt, dann muss man wieder darum kämpfen.“
Und auch mit über 50 ist Susanne Trauer noch eine kämpferische Frau. Heute engagiert sie sich zum Beispiel für Flüchtlinge und kann gerade in diesem Zusammenhang wenig Verständnis für Menschen aufbringen, die nun wieder Mauern rund um Europa errichten wollen. Aufgewachsen mit drei Geschwistern gehört das Miteinander, das aufeinander Rücksicht nehmen für sie einfach dazu. Statt nach 25 Jahren Wiedervereinigung zu sehen, wie gut es uns im Vergleich zu einem großen Teil der Welt geht, wollen viele nicht teilen und sind erschreckend bequem geworden. „Ich finde diese Sattheit echt zum Kotzen“, formuliert es Susanne Trauer ganz drastisch.
Gerade im Moment stelle sich für uns alle die dringende Frage, wie wir als Gemeinschaft mit den Flüchtlingen in unserem Land umgehen können, ob wir in der Lage sind, für diese neue Situation neue Lösungen zu finden. Denn Antworten auf die aktuellen Probleme werden wir ihrer Ansicht nach nicht im Geschichtsbuch finden.
Heinrich Schulze
WOHNORT ZWICKAU – RENTNER
Als Leiter des Zwickauer Puppentheaters hat sich Heinrich Schulze über viele Jahre einen Namen gemacht und bis heute ist er als Geschichtenerzähler, Puppenspieler und Maler tätig, Rentnerdasein hin oder her. Die Wende hat er als aufregende Zeit in Erinnerung: Man kam gar nicht zur Ruhe. Von der Grenzöffnung selbst erfährt Heinrich Schulze erst einen Tag später im Radio, sitzt dann den ganzen Tag vor dem Fernseher, um das Geschehen zu verfolgen.
Welche Konsequenzen die Wiedervereinigung für sein Leben hat, darüber macht er sich damals wenige Gedanken. „Was kommt, kommt“, sagt er lächelnd. Dass die Wende so friedlich ablief, bezeichnet er als großes Wunder. „Das größte Wunder überhaupt, wo gibt es das schon, dass ein solcher gesellschaftlicher Umbruch ohne einen Tropfen Blut abgegangen ist.“ Umso weniger kann Heinrich Schulze verstehen, wie man sich die Zustände vor 1989 zurückwünschen kann. „Wenn ich mir vorstelle, es gäbe jetzt einen großen Knall und wir hätten die Situation von 1988 oder ´89 wieder, dann möchte ich den sehen, der sagt, das möchte ich unbedingt wiederhaben.“ Es würden heutzutage viel zu viele Menschen vergessen, wie schlecht es Ende der 80er Jahre um die DDR bestellt war.
Natürlich war nicht alles negativ, sagt Heinrich Schulze und nennt das Beispiel Bildungssystem. Auch kritisiert er die Fehler, die vor 25 Jahren gemacht worden und seiner Ansicht nach bis heute nachwirken. All die Betriebe, die „verschachert“ worden – das ist für ihn der größte wirtschaftliche Niedergang, der so nicht hätte sein müssen. Auf Seiten der Westdeutschen gab es eine gewisse Siegermentalität, die dazu geführt hat, dass alles Ostdeutsche per se als schlecht beurteilt wurde. Beide Seiten haben die Chance vertan, ihre unterschiedlichen Erfahrungen auszutauschen. Dabei sind die Ostdeutschen die Sieger dieser friedlichen Revolution, denn sie haben ein System gestürzt. „Da hat sich viel böses Blut aufgebaut.“ Und das führt seiner Meinung nach dazu, dass es immer noch Menschen gibt, die „ihrer verlorenen DDR“ nachtrauern.
Heinrich Schulze betrachtet auch den Kapitalismus kritisch und sieht viele Probleme, die wir bewältigen müssen. Doch die Wiedervereinigung bedeutet für ihn vor allem Freiheit. Als Kunstliebhaber beispielsweise kann er nun endlich dorthin fahren, wo er Kunstgeschichte live erleben kann. Da hat er beim Anblick so manches Kunstschatzes, mancher schönen Landschaft oder Stadtansicht fast geweint vor Glück und auch Wut, dass das einem ganzen Volk so lange vorenthalten wurde.
25 Jahre nach der Wiedervereinigung ist für Heinrich Schulze das Kapitel DDR abgeschlossen, er vermisst die DDR nicht, aber sie gehört zu seinem Leben und hat es natürlich geprägt. Was aus ihm geworden wäre, wenn es die DDR noch gäbe? Sehr wahrscheinlich nicht der Leiter des Puppentheaters Zwickau, denn dafür hätte er in die Partei eintreten müssen – und das stand für ihn nicht zur Debatte. Ob ihn die Stasi im Visier hatte, kann er nicht genau sagen, seine Akte hat er zwar beantragt. Doch gefunden wurde nur ein leerer Ordner und man forderte ihn auf, später nachzufragen. Das hat er dann unterlassen.
Allerdings erzählt er, dass er damals nach seinem Umzug von Berlin an die Mulde in die Wohnung eines ehemaligen Puppenspielers eingezogen war. Nach der Wende erfuhr dieser Mann, dass die Wohnung verwanzt war und die Stasi über ihn 1.400 Seiten Bericht geführt hatte. Doch Heinrich Schulze nimmt nicht an, dass die Wanzen vor seinem Umzug entfernt worden sind. „Da brauchen wir uns doch nichts vormachen: In jeder Brigade gab es einen, der zugehört hat – das war nun mal so. Das ist nämlich das, was die Leute auch vergessen.“
Selbst in der Künstlerszene wusste man nie genau, wer für die Stasi zuhörte. Wenn man sich über Politik unterhielt, suchte man sich einen ruhigeren Ort, da man nie wusste ob ein Spitzel dabei war. Mit seinen Westverwandten hielt Heinrich Schulze zudem Kontakt über Telefon und Briefe. „Wenn oft nach vielen Stunden die Telefonverbindung endlich zustande kam, hörte man es klacken und wusste, ab jetzt wird abgehört.“ Da schätzt er die Freiheiten des wiedervereinten Deutschlands trotz aller derzeitigen Probleme.
Hassan Soilihi Mzé
JAHRGANG 1982 – GEBURTSORT ZWICKAU – WOHNORT LEIPZIG – HISTORIKER
Hassan Soilihi Mzé kennt die DDR nur aus Kindheitstagen, doch der sozialistische Staat hat sein Leben geprägt und prägt es bis heute. Sein Vater ist auf den Komoren, einem Inselstaat bei Madagaskar, geboren und damit französischer Staatsbürger. Ab Ende der 70er Jahre arbeitet er als Koch für französische Ingenieure im Sachsenring, so lernen sich seine Eltern kennen und lieben. Doch obwohl sie verheiratet sind, zwei Kinder haben und gemeinsam in Wilkau-Haßlau leben, erhält der Vater nie eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.
1986 verwehrt die DDR dem „kapitalistischen Staatsfeind“ endgültig die Einreise. Die Ehe geht in die Brüche, der Kontakt reißt ab. „Kurzum: Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Entschieden haben das aber andere, nicht meine Eltern, nicht meine Mutter, das hat ein Staat entschieden.“
Derzeit ist der Historiker auf Spurensuche nach seinem Vater. Wut im Bauch fühlt er angesichts dieser „Entwurzelung“ nicht, aber einen zielgerichteten Zorn gegen eine verklärende DDR-Erinnerungskultur. Besonders wenn Menschen, die in der DDR gelebt haben, rückblickend zum Beispiel das Engagement des Staates für Familien loben. Dass er nicht zur Adoption freigegeben wird, verdankt er seiner Mutter, die sich für ihre Kinder und gegen ihre Ehe entscheidet. Denn sie hätte mitgehen können, allerdings ohne Hassan Soilihi Mzé und seinen Bruder.
25 Jahre nach dem Mauerfall sieht er die DDR aber nicht nur mit Blick auf das eigene Schicksal kritisch. Sorgen bereitet ihm heute die Haltung mancher junger Menschen. Gerade in prekären Milieus, wo Arbeitslosigkeit zum Alltag gehört, wird seiner Ansicht nach die Frustration über die Deutsche Einheit weitervererbt. So fühlen sich manche als Wendeverlierer, obwohl sie diese Zeit gar nicht erlebt haben. Auch er hat als Jugendlicher in den 90er Jahren den Zusammenbruch der DDR vorrangig mit Arbeitslosigkeit assoziiert, dieses Bild aber als Erwachsener korrigiert. Er ist überzeugt, dass sich in den vergangenen 25 Jahren viel bewegt hat. Deutschland ist auf einem guten Weg.
Die Gesellschaft ist insgesamt deutlicher bunter geworden, auch wenn das aktuelle Beispiele vergessen machen. Doch einige haben noch immer eine Mauer im Kopf und das Gefühl, mit der Wende verloren zu haben. Seiner Meinung nach tragen manche politische Akteure eine gewisse Verantwortung an dieser „Verlierer-Stimmung“, wenn sie noch immer ein „Zuckerguss-Bild“ der DDR transportieren und damit ein weiteres Zusammenwachsen verhindern. Das jedoch wird sich nach Überzeugung von Hassan Soilihi Mzé letztendlich nicht aufhalten lassen: In 25 oder spätestens 50 Jahren spricht seiner Ansicht nach niemand mehr über Ossis und Wessis.
Den Mauerfall selbst erlebt er als Kind nicht bewusst, hat nur noch wenige Erinnerungen. So sieht er noch vor sich, wie aufgeregt seine Oma und Mutter sind, als sie die Bilder im Fernsehen verfolgen. Bewusst wahr nimmt er hingegen die aufkommende Fremdenfeindlichkeit in den 90er Jahren. Auch wenn er schon als Kind aufgrund seines Aussehens eine gewisse Andersartigkeit spürt, wird das als Jugendlicher erst richtig deutlich. Seine Erfahrungen reichen von institutionellem Rassismus beispielweise auf Ämtern, wo man aus einer falschen Hilfsbereitschaft heraus immer besonders laut und deutlich mit ihm spricht, bis zur Gewaltandrohung.
Zwei Ereignisse sind ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben: So läuft er Mitte der 90er am Ende der Sommerferien an einem Parkplatz in seiner Heimatstadt Wilkau-Haßlau vorbei. Dort steht eine Gruppe mit Leuten aus der bekennenden rechten Szene, er wird beschimpft und angepöbelt. Doch jeder andere Weg wäre ein riesiger Umweg, also besinnt er sich auf die Worte seiner Oma, verbirgt seine Angst und drückt den Rücken durch. „Dann sah ich, wie einer eine Pistole zog, auf einmal knallte es und dann bin ich gerannt.“ Hassan Soilihi Mzé nimmt bis heute an, dass es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt hat. Eine Anzeige bei der Polizei bleibt ohne Folgen.
Nach einem Theaterbesuch in Zwickau erlebt er auf dem Weg zum Bus Ähnliches. Wieder wird er von kahl geschorenen Männern verfolgt, erst langsam, dann immer schneller. Hassan Soilihi Mzé läuft weg, rennt schließlich so schnell er kann und versteckt sich in einem Hauseingang. „Da habe ich mich reingepresst und dann sind die, wie in einem schlechten Film, vorbeigerannt. Und haben sich auch nicht umgedreht.“ So etwas ist ihm in Leipzig, wo er heute lebt und an seiner Dissertation arbeitet, noch nicht passiert. Doch auch in der Messestadt gibt es Gegenden, die er zu bestimmten Tageszeiten lieber meidet.
Jens Buschbeck
JAHRGANG 1966 – GEBURTSORT ERLABRUNN – WOHNORT ZWICKAU – PFARRER FÜR GEMEINDEAUFBAU LUTHERGEMEINDE ZWICKAU
„So viele intensive Erlebnisse habe ich in einem Jahr in meinem Leben nie wieder gehabt“, erinnert sich Jens Buschbeck 25 Jahre nach der Wende an diese Zeit zurück. Er studiert damals gerade Theologie in Leipzig, erlebt die Montagsdemos vor der Nikolaikirche ebenso hautnah wie die Friedensgebete in der Zwickauer Lutherkirche, wenn er am Wochenende nach Hause fährt.
Zwar ist er nicht in vorderster Front als Organisator dabei, kennt jedoch viele Kommilitonen, die sich für eine andere DDR stark machen – und dafür Kopf und Kragen riskieren. „Du hast Dienstagfrüh in der Vorlesung immer geguckt, wer ist noch da und wer wurde verhaftet“, sagt Jens Buschbeck. So kommt sein damaliger Zimmergenosse nach einem Tag in Stasihaft mit grauen Strähnen im Haar wieder, erinnert sich der Pfarrer für Gemeindeaufbau der Zwickauer Lutherkirchgemeinde. „Es war über der ganzen Stadt so eine schlimme Spannung – auf der einen Seite Trotz und auf der anderen Seite Angst. Man wusste, was auf einen zukommt.“
Denn wie der sozialistische Staat mit Andersdenkenden verfährt, erlebt Jens Buschbeck am eigenen Leib mit seiner Entscheidung für das Theologie-Studium und damit für ein Leben als Pfarrer. Aufgewachsen zwischen zwei Welten, sprich einem Vater im Schuldienst und einer Mutter, die sich in der Kirche engagiert, versucht Jens Buschbeck als Jugendlicher den Spagat zwischen Anpassung und gelebtem Glauben.
Als er 1987 die Zusage zum Studium erhält, ist er noch Soldat in der Nationalen Volksarmee – und sieht sich anschließend einem massiven Druck ausgesetzt. Aus fadenscheinigen Gründen werden ihm der Urlaub oder der wöchentliche Ausgang gestrichen. Kameraden tragen Kleinigkeiten an die Offiziere weiter und denunzieren ihn ganz offen im Namen der Stasi. „Das sind Dinge, an die man sich nicht gerne erinnert.“
Auch seine Eltern erleben diverse Schikanen. So kostet sein Studium den Vater fast die Stelle als Lehrer. Das alles erzählen sie ihm erst nach der Wende, über die er sehr froh ist. Heute kann er seinen Glauben frei leben, das Gefühl des Eingesperrt seins ist weg. Er findet es jedoch schade, dass viele nach wie vor eine Mauer im Kopf haben. Das fällt ihm insbesondere in seiner Generation immer wieder auf.
Durch seine langjährige Arbeit als Jugendpfarrer kennt er ganz Deutschland, hat mit vielen Ost- wie Westdeutschen zusammengearbeitet und kann höchstens regionale Unterschiede ausmachen. In der Kategorie Ossi und Wessi hingegen denkt er nicht.
Die DDR ist in seiner Familie hin und wieder Thema, weil sich seine drei Kinder für seine Erlebnisse während der Wendezeit interessieren. Diese Rückschau auf sein Leben ist Jens Buschbeck wichtig, ohne dass er in der Vergangenheit lebt. Seine Stasiakte hat er deshalb nie beantragt. Er muss schon bei seinen Eltern erleben, wie sehr es sie trifft, im Nachhinein von vermeintlich guten Nachbarn zu erfahren, dass sie bei der Stasi waren. Das will er sich zum einen ersparen, zum anderen will er diesen Menschen ebenfalls einen Neuanfang zugestehen.
Während seiner Armeezeit in Erfurt lernt er einen älteren Herrn kennen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, junge Soldaten zum Essen einzuladen. So hat er es einst selbst als Soldat erlebt und führt die Idee als Tradition fort. Jens Buschbeck lernt viel von dem väterlichen Freund, der ebenso Theologie studiert und als Bibliothekar gearbeitet hat. Zudem musste er die Gestapo erleben. „Er hat mir die Augen geöffnet über vergleichbare Strukturen vom Dritten Reich zur DDR“, erinnert sich Jens Buschbeck. Die Gespräche erweitern seinen Horizont, der Vergleich von Propagandamaterial der beiden deutschen Staaten tut sein Übrigens. Noch heute haben die beiden Männer Kontakt. Erst letztes Jahr durften Jens Buschbeck und ein weiterer ehemaliger Soldat mit dem Freund den 100. Geburtstag feiern.
Trotz all der Repressalien, trotz seiner differenzierten Sicht auf die DDR denkt Jens Buschbeck nie an eine Flucht. „Ich habe als Christ meine Aufgabe hier“, begründet er diese Entscheidung. Zudem geht es rückblickend seiner Einschätzung nach vielen Christen auf der Welt weitaus schlechter, weil sie ihren Glauben leben, als das in der DDR der Fall war.
Reinhard Riedel
JAHRGANG 1962 – GEBURTSORT ZWICKAU – WOHNORT ZWICKAU – FREIBERUFLICHER PROJEKTDIENSTLEISTER
Der Pfarrerssohn Reinhard Riedel hat die meiste Zeit seines Lebens in Zwickau verbracht. Hier erlebt er auch die Wende anfangs sehr euphorisch, doch bald stellt sich die Ernüchterung ein. Denn schnell wird ihm bewusst, dass für einen dritten Weg, eine Alternative neben BRD und DDR, weder der Wille vorhanden ist noch die Zeit.
Vom Mauerfall hört Reinhard Riedel erst am nächsten Morgen zur Frühschicht im Radio. Die Freude ist groß, auch darüber, dass er seine Verwandten in West-Berlin wiedersehen kann, die das sozialistische Land in den 80ern verlassen hatten. Er selbst hat jedoch nie ernsthaft über eine Flucht nachgedacht. Stattdessen plant er zusammen mit seiner Frau die Eröffnung eines Kulturcafés und damit ein Leben in der Nische, auch wenn er sich damit wohl „nicht viele Freunde“ gemacht hätte. Doch angesichts der rechtlichen Unsicherheit im Herbst 1989 begraben sie die Idee zunächst. Ganz gestorben ist sie allerdings nicht: Reinhard Riedel engagiert sich ab der Wendezeit im Friedenszentrum, einem der Vorläufer des Alten Gasometers, heute das soziokulturelle Zentrum der Stadt. Die DDR ist für Reinhard Riedel noch ein großes Thema, sowohl in Gesprächen mit Freunden als auch im Familienkreis. Allerdings nicht verklärend, sondern nach 25 Jahren sogar deutlich differenzierter als kurz nach der Wende. „Diese Auseinandersetzung finde ich nach wie vor wichtig, dass man durchaus selbstbewusst sagen sollte, das Leben vor der Vereinigung war nicht minderwertig oder war nur halb gelebt, sondern wir haben genauso intensiv gelebt wie heute.“ Das hat seiner Ansicht nach nichts mit Beschönigen zu tun, sondern bildet die Ausgangsbasis für das individuelle Herangehen an dieses Stück deutsche Geschichte.
„Das System DDR vermisse ich nicht“, sagt Reinhard Riedel klar und deutlich. Beide Lebensabschnitte haben ihn geformt, seine DDR-Sozialisation hat ihn geprägt und macht ihn auch heute zu einem kritischen Menschen. So hat das wiedervereinte Deutschland seiner Ansicht nach eine große Angleichung erfahren, auch wenn nicht alles gleich ist. Gerade kulturelle Unterschiede können dem Projektdienstleister zufolge, der unter anderem das Mondstaubtheater mit auf die Beine stellt, aber auch für einen kreativen Austausch von Nutzen sein.
Statt nach 25 Jahren von Ost und West zu sprechen, sollten wir uns eher die Frage stellen, wie unsere Gesellschaft insgesamt zusammenwachsen kann. Die Unterschiede zwischen arm und reich werden größer und es fällt der Gesellschaft seiner Meinung nach schwer, Asylsuchende angemessen aufzunehmen. „Das sind zwei aktuelle Beispiele für Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen.“
Liane Nass-Khaled
JAHRGANG 1942 – GEBURTSORT ANNABERG-BUCHHOLZ – WOHNORT ZWICKAU – RENTNERIN
Liane Nass-Khaled ist seit elf Jahren Rentnerin, nachdem sie ein Leben lang als Erzieherin und Leiterin eines Kindergartens ihren Traumberuf gelebt hat. Ein ruhiges Rentnerdasein führt die Zwickauerin trotzdem nicht: Auch nach 45 Jahren als Übungsleiterin bringt sie wöchentlich vier Sportgruppen auf Zack, obwohl sie meist deutlich älter ist als ihre Teilnehmer.
Bereits zu DDR-Zeiten ist Liane Nass-Khaled sportlich aktiv: Vor ihrer Heirat und der Geburt der Tochter ist sie Leistungssportlerin, soll sogar zur Fecht-Weltmeisterschaft fahren. Mit der Familiengründung und dem Umzug von Chemnitz nach Zwickau legt sie das Florett zur Seite, engagiert sich dafür unter anderem im Breitensport.
Ob Wohnsportgruppe, DRK oder Deutsch-Sowjetische Freundschaft – Liane Nass-Khaled will ihr Umfeld mitgestalten. Entsprechend erinnert sie sich an die DDR als eine „große Familie“, in der sie nichts auszustehen hat. Sie hat sich wohlgefühlt. „Es gab nichts, worüber ich mich hätte beschweren können“, sagt sie rückblickend. Erst ab 1986 ist ihrer Einschätzung nach deutlich zu spüren, dass es bergab geht.
Doch obwohl sie sehr gerne in der DDR lebte, will sie den sozialistischen Staat nicht zurück, zumal dieser ihrer Meinung nach nicht hätte weiterbestehen können. „Die DDR ist für mich ein abgeschlossenes Kapitel.“ Hinzu kommt nach der Wende eine große Enttäuschung, als sie erfährt, wie der Staat mit Andersdenkenden verfahren ist. Die neue Meinungsfreiheit nach der Wiedervereinigung schätzt sie daher sehr.
Das heutige System sieht die Rentnerin ebenso kritisch. Sie wünscht sich eine neue Gesellschaftsordnung, die nicht so brutal und ausbeuterisch ist, in der es nicht nur um Geld und Macht geht. Denn das ist für sie das Wesen des Kapitalismus – ein Bild, das sich durch Besuche der Westverwandtschaft ihres ersten Mannes eingeprägt hat.
Der Mauerfall kommt für Liane Nass-Khaled genauso plötzlich wie für viele andere. Doch die Euphorie ihrer Mitbürger kann sie aufgrund der Erzählungen ihrer Schwägerin nicht so recht teilen. „Ich war nicht so erfreut, muss ich ehrlich sagen.“ Zudem fühlt sie sich vereinnahmt, die politische Wende geht ihr zu schnell, auch wenn sie durch die neu gewonnene Reisefreiheit viele nette Menschen kennenlernt. Entsprechend nüchtern fällt ihr Fazit zu 25 Jahren Deutscher Einheit aus: „Wir sind noch kein Deutschland.“ Doch als Optimistin aus Überzeugung hofft sie, dass es nicht nochmal 25 Jahre dauert, bis sich Ost und West auf Augenhöhe begegnen.
Die begeisterte Sportlerin hatte gedacht, dass sich Ost- und Westdeutsche schneller verstehen würden. Doch 40 Jahre Teilung bedeuten andere Lebensgeschichten, andere Erfahrungen. „Es ist klar, dass das ein langer Weg ist.“ Leider merkt man auch heute noch, dass mancher Westdeutscher denkt, dass die Ostdeutschen ihm etwas wegnehmen.
Vom Mauerfall selbst hat Liane-Nass Khaled zunächst gar nichts mitbekommen. Erst als sie am 10. November 1989 nachmittags von einer Berliner Freundin auf Arbeit angerufen wird, hört sie vom Weltereignis. „Liane komm‘ her, die Grenzen sind auf, keiner schießt“, erinnert sich die ehemalige Erzieherin an das Telefonat. Also macht sie sich sofort auf den Weg nach Berlin. Der Ostteil der Stadt ist durch die Verbandsarbeit damals fast ihre zweite Heimat, nun lernt sie endlich auch den Westteil kennen. „Als ich über die Grenze bin, das war schon ein eigenartiges Gefühl. Überall stand die Polizei, die waren auch bewaffnet, aber es war alles ruhig und friedlich.“ Als sie zurück nach Zwickau fahren will, ist der Zug so überfüllt, dass sie sofort wieder aussteigt und einen Tag länger in Berlin bleibt.
In Berlin hätte sie 1959 auch die Chance zur Flucht aus der DDR gehabt. Mit einer Freundin macht die damals 17-Jährige Urlaub am brandenburgischen Scharmützelsee, als diese bei einem Ausflug nach Berlin auf die Idee kommt, abzuhauen. Doch als Liane Nass-Khaled auf dem Kudamm steht, bekommt sie kalte Füße und will nur noch nach Hause. Als zwei Jahre später die Berliner Mauer gebaut wird, versteht sie die Welt nicht mehr, bereut ihren Rückzieher aber keine Minute. Im Gegenteil, sie hat sich immer gefragt, was all den Menschen wohl passiert sein mag, die mit einem Sprung in die Spree oder dem Bau eines Tunnels ihr Leben riskiert haben, um in den Westen zu kommen.
Heute ist die lebensfrohe Rentnerin trotz aller Höhen und Tiefen froh über die offenen Grenzen. Immerhin hätte sie sonst wohl kaum ihren zweiten Mann kennengelernt, einen kurdischen Syrer, der in seiner Heimat unter politischer Verfolgung litt. Mit 67 Jahren hat sie nochmal „Ja“ gesagt und freut sich schon jetzt auf das verflixte siebte Jahr.
Andrea Haberl
JAHRGANG 1966 – GEBURTSORT TETEROW – WOHNORT ZWICKAU – BUCHHALTERIN BEI VW
Andrea Haberl hat die DDR jeden Tag vor Augen, wenn sie sich in ihrer Wohnung umsieht. Die Mutter von drei Kindern sammelt leidenschaftlich gern Spielsachen, Kinderbücher und Schallplatten aus dieser Zeit. In ihrer Familie ist das Leben vor der Wende daher immer wieder Thema, sie erinnert sich oft und gern zurück. „Vermissen tue ich die DDR aber sicher nicht“, sagt Andrea Haberl mit Nachdruck. „Ich hänge nur an diesen Dingen.“ Zudem geht es ihr heute gut und sie hat von der Wende profitiert, da ihre Lehrjahre bei Sachsenring von ihrem neuen Arbeitgeber Volkswagen anerkannt wurden und sie somit mehr als 30 Jahre Betriebszugehörigkeit vorweisen kann.
Angesichts ihrer Sammelleidenschaft ist dieser Widerspruch aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Es sind wohl vor allem der familiäre Zusammenhalt in der DDR-Gesellschaft und die Kollegialität im Betrieb, die Andrea Haberl als Verlust empfindet und denen sie ein wenig nachtrauert. Trotzdem denkt sie nicht in den Kategorien Ossis oder Wessis – im Gegenteil. „Also da kriege ich Wut, da kriege ich auch nach 25 Jahren noch Wut, wenn noch solche Unterschiede gemacht werden.“ Dafür kennt sie das Klischeedenken anderer nur zu gut.
Andrea Haberl kann sich noch genau an die Aufregung der Arbeitskollegen in den alten Bundesländern erinnern, als 13 Jahre nach der Wende die Gehaltsabrechnung für Standorte in Köln oder Hamburg über Chemnitz laufen sollte. Da hätte sich mancher einen Anwalt genommen aus Angst vor einer „Busch-Zulage“. Inzwischen haben sich diese Bedenken jedoch gegeben.
Den Mauerfall selbst erlebt Andrea Haberl vor dem Fernsehgerät. „Mir blieb der Mund offen stehen“, erinnert sie sich. Gleich nach der Grenzöffnung ist sie mit einer Freundin nach Hof gefahren, hat den Ansturm der ‚Ossis‘ auf die bayerische Stadt mit- erlebt – und nicht nur als positiv empfunden. „Die vielen Massen, die dort in Hof waren, nur weil man die 100 D-Mark haben wollte. Klar, man hat sie geholt, aber man hat sich manchmal auch ein bisschen geschämt.“
25 Jahre nach der Wiedervereinigung empfindet Andrea Haberl Deutschland in großen Teilen als ein geeintes Land, wenn gleich ihre Generation noch die größten Unterschiede macht. Und auch wenn sie sich gern an ihr Leben in der DDR zurückerinnert, ist ihr doch bewusst, dass es 1989 nicht so hätte weitergehen können. Schlussendlich ist sie froh, dass die Mauer gefallen ist.
Doch auch wenn sie plötzlich keine Mauer mehr daran hinderte, die Welt zu sehen, hat die neue (Reise-)Freiheit die gebürtige Mecklenburgerin nur bedingt gereizt. „Auf keinen Fall habe ich gedacht: Oh ja, jetzt kannst du die Welt bereisen, du hast 23 Jahre nichts gesehen. Erstens war es nicht so und ich habe es auch nicht so empfunden.“ Zu DDR-Zeiten ist sie mit ihrer Familie zu sechst in den Harz gefahren, auch heute noch zieht sie Urlaubsziele in Deutschland vor – nur mit einem größeren Auto.
Dass ihre Biografie für eine ostdeutsche Frau ihres Alters sehr geradlinig verläuft, ist Andrea Haberl bewusst. „Ich bin dankbar dafür.“ Ihre Lehre zum Wirtschaftskaufmann (so hieß das damals auch für Frauen) führte sie in den 80er Jahren von Mecklenburg-Vorpommern, wo es schon zu DDR-Zeiten wenige Lehrstellen gab, ins Sachsenring-Werk nach Zwickau. Jeden Freitag fuhr sie mit dem Zug „hoch“. Das halbe Abteil kannte sich, da viele Eggesiner auch nach Sachsen gegangen waren. Das Schicksal meinte es dann in der Wendezeit gut mit ihr: Als Volkswagen seinen Standort in Sachsen gründete, wurden ganze Abteilungen des Sach-senring übernommen und auch sie als Buchhalterin wurde gebraucht.
Volker-Schneider
JAHRGANG 1959 – GEBURTSORT NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE/RHEINLAND-PFALZ – WOHNORT ZWICKAU – GESCHÄFTSFÜHRER DER ZWICKAUER ENERGIEVERSORGUNG
An den 9. November 1989 kann sich Volker Schneider noch genau erinnern: In den Heute- Nachrichten hört er zum ersten Mal von der Presseerklärung Günther Schabowskis. Bis in die Nacht hinein verfolgt er die Geschehnisse, sieht die ersten DDR-Bürger über die Grenze kommen. Noch heute hat er diese Fernsehbilder im Kopf. Das Besondere für ihn: Seine Ehefrau, die im Osten geboren ist und kurz vor dem Mauerbau mit ihren Eltern flüchtete, feiert zwei Tage später ihren 30. Geburtstag. „Spät in der Nacht haben wir noch Besuch aus dem Osten bekommen. Das war schon ein Highlight“, erinnert sich der Geschäftsführer der Zwickauer Energieversorgung (ZEV).
Durch seine Frau konnte der gebürtige Pfälzer daher bei Besuchen der Ost-Verwandtschaft bereits ab 1985 jedes Jahr Ost-Luft schnuppern. Als er 1991 seine Ausbildung zum Bilanzbuchhalter in der Abendschule beendet hat, will er nach mehreren Arbeitsjahren in Kaiserlautern als Bankkaufmann und Geschäftsführer der Volkshochschule nochmal etwas ganz anderes machen. Die Himmelsrichtung ist ihm dabei egal und so reagiert er auf eine Stellenanzeige in Zwickau – und ist seit 1992 Chef der ZEV.
Weil er nicht als Pendler jede Woche 1000 Kilometer auf den vor allem im Osten teilweise noch „katastrophalen Autobahnen“ verbringen möchte, entscheidet sich die ganze Familie im Oktober 1992 zum Umzug. Vor allem Freunde reagieren mit viel Unverständnis, dass er sein vertrautes Umfeld verlässt, sein Haus aufgibt. Das bittere Ergebnis: „Mein Freundeskreis, den ich damals hatte, existiert nicht mehr.“
Seiner Meinung nach ist Deutschland 25 Jahre nach der Wiedervereinigung bereits zusammengewachsen und man sollte nicht länger diskutieren, wer was hat, sondern insgesamt sehen, dass es Deutschland „verdammt gut“ geht. Unterschiede findet er zum großen Teil nur noch rückblickend. Zudem machen die regionalen Besonderheiten Deutschland seiner Meinung nach erst aus. Die Ost-West-Diskussion hält er daher für überflüssig. „Es muss genauso sein, als wenn jemand von Hamburg nach München zieht als wenn er eben von Kaiserslautern nach Zwickau kommt.“
Seinen ersten Besuch in der Schumannstadt hat der Zahlenmensch nie vergessen: Am 16. Juni 1992 war er im Rathaus zum Einstellungsgespräch geladen. Beim Anblick der maroden Gebäude fragt er sich, ob seine Entscheidung richtig war. Letztendlich war es für Volker Schneider der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser, den er auch nach 23 Jahren nie bereut hat.
Eine Rückkehr in die Pfalz steht für Volker Schneider ohnehin nicht mehr zur Debatte. Zudem müsste er allein gehen. Nach der Heirat beider Kinder und der Geburt der drei Enkel hätten die Sachsen in der Zwischenzeit die deutliche Mehrheit in der Familie.
Neben den augenscheinlichen Mängeln in der Infrastruktur fielen Volker Schneider in den ersten Monaten nach seinem Umzug vor allem die kleinen Unterschiede in der Mentalität auf. So hielt er es bei seiner ersten Lohnabrechnung zunächst für einen Irrtum, dass die Kirchensteuer niedriger war als der Solidaritätszuschlag. Daran hat er sich inzwischen gewöhnt, doch mit dem Familienbild in der ehemaligen DDR konnte sich Volker Schneider nur schwer anfreunden.
Selbst heute ist es ihm noch ein bisschen fremd, dass ostdeutsche Frauen nur Monate nach der Geburt eines Kindes zurück an den Arbeitsplatz wollen, obwohl er sich nie als Macho bezeichnen würde. Selbst seine eigene Tochter nahm nur ein Jahr Elternzeit, da habe er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. „Jetzt hat sie ihr zweites Kind und sie sagt, im September geht sie wieder arbeiten, wenn das Kind ein Jahr alt ist – also da muss ich schon durchschnaufen.“ Auch wenn sein konservatives Herz bei diesem Gedanken ein wenig blutet, so ist er doch froh darüber, in einem Land zu eben, in dem derartige Fragen jeder für sich beantworten kann.
Alfred Staindl
JAHRGANG 1969 – GEBURTSORT WIEN – WOHNORT LENGENFELD – TÄTIG IN DER MOBILEN BEHINDERTENHILFE
Alfred Staindl kam vor vier Jahren nach Deutschland und sein Leben drehte sich damit um 180 Grad. Nach 25 Jahren als Bankkaufmann in Wien entscheidet er sich für einen völlig neuen Weg: Er macht eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und arbeitet heute für die Mobile Behindertenhilfe der Stadtmission Zwickau. Zuvor kannte der gebürtige Österreicher Zwickau nur als Trabi-Stadt.
Von der DDR wusste er so gut wie nichts, denn in seiner Schulzeit war die Teilung der beiden deutschen Staaten ein „Randgebiet“. Lediglich bei großen Sportereignissen rückte das Thema ins Blickfeld, wobei die DDR in seiner Erinnerung als Dopingland schlecht wegkam.
Vom Mauerfall erfährt Alfred Staindl aus dem Fernsehen. Er freut sich für die Menschen des wiedervereinten Deutschlands, da „das größte Gefängnis der Welt“ endlich Geschichte ist. Inzwischen hat er in Zwickau Wurzeln geschlagen und will nur noch als Besucher zurück in seine alte Heimat. „Ich habe in der Zeit, in der ich hier lebe, für mich persönlich mehr erreicht als in den letzten 10 Jahren in Österreich“, sagt Alfred Staindl. Im Herzen ist er aber durch und durch Österreicher, wobei gerade der Abstand zu seinem Heimatland wertvoll für ihn ist.
In Zwickau fühlt er sich sehr wohl, er mag die Mentalität der Menschen in dieser Region. „Ich denke, dass hier in Ostdeutschland – und ich hoffe, es bleibt auch so – das Zwischenmenschliche, dieses Gemeinsame, dieses Gemütliche ein sehr wichtiger Faktor ist.“ Wenn er hingegen die Menschen aus den alten und den neuen Bundesländern vergleichen müsste, ist der typische ‚Wessi‘ seiner Erfahrung nach eher auf Geld, Erfolg, Karriere und Status fokussiert. „Jeder möchte besser sein als der Andere. Das ist auch in Wien so.“ Und etwas, worauf er gern verzichten kann. Vor eine Entscheidung gestellt, sieht er sich als geborener ‚Ösi‘ eher als ‚Ossi‘. Wobei diese Unterscheidung in seinem persönlichen Leben keine Rolle spielt, er das „klaffende Gefühl und die Vorurteile“ jedoch schon häufig beobachtet hat.
Seine Meinung zu 25 Jahren Deutscher Einheit fällt daher eindeutig aus: Es wird noch 10 bis 20 Jahre dauern, bis Deutschland wirklich vereint ist und die vorhandenen Vorurteile ad acta gelegt sind. Man müsste endlich damit anfangen, das Land als Ganzes zu sehen und aufhören, die Ostdeutschen für 40 Jahre DDR zu verurteilen. Sie hätten sich das Eingesperrt sein schließlich nicht ausgesucht.
Josi, Marie, Lena, Pauline, Eric, Kevin, Laura, Sara und Chris – das Projektteam „25 Jahre-25 Menschen-25 Geschichten“. Nahezu ein halbes Jahr lang haben sie in ihrer Freizeit – also neben Schule oder Ausbildung – an diesem Projekt gearbeitet. Aus anfänglicher Unkenntnis über die beiden deutschen Staaten wurde echtes Interesse an Geschichte und Geschichten.
Marie (17): „Beeindruckt hat mich, dass die Menschen noch so detaillierte Erinnerungen an die DDR und die Wendezeit hatten. Wir können alle stolz auf unsere Leistungen von den vergangenen Monaten sein.“
Lena (14): „Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die vielen Geschichten, welche die Menschen zu erzählen hatten. Beeindruckt hat mich, dass früher komplett andere Verhältnisse geherrscht haben und enttäuscht hat mich auch nichts. Aus dem Projekt nehme ich vor allem mehr Wissen über die DDR mit und ich bin stolz auf unser fertiges Projekt.“
Josephine (16) „Besonders in Erinnerung geblieben sind mir die vielen, teilweise erschreckenden Geschichten über die Stasi geblieben. Beeindruckt hat mich, dass der Mauerfall für viele Menschen eine 180° Grad Drehung in ihrem Leben war. Enttäuscht hat mich nichts. Aus dem Projekt nehme ich viel mehr Wissen über die DDR-Zeit mit und dass wir alle stolz auf unser fertiges Projekt sein können.“
In diesem Projekt haben wir viel über die jüngste deutsche Geschichte gelernt – Wissen, das so in keinem Geschichtsunterricht in dieser direkten Form vermittelt werden kann. Außerdem hat uns dieses Projekt noch viel mehr gebracht. Wir haben gelernt wie man Interviews führt und redaktionell bearbeitet. Wir haben gefilmt, Filme geschnitten und den Ton gemischt, fotografiert und Fotos sowie Grafiken bearbeitet. Bei all dem wurden wir professionell unterstützt von der freien Journalistin Claudia Drescher, dem Medienpädagogen des SAEK Alexander Karpilowski und dem freien Fotografen Helge Gerischer.
Die Ausstellung unseres Projektes „25 JAHRE. 25 MENSCHEN. 25 GESCHICHTEN“ konnte an den folgenden Orten besucht werden.
- 29.02.2016 – 01.04.2016 in der Geschäftsstelle der Zwickauer-Energie-Versorgung
- 11.04.2016 – 06.05.2016 im Rathaus Zwickau
- 12.11.2015 – 13.11.2015 zu den „Jugend-Geschichtstagen“ im sächsischen Landtag Dresden
- 3.10.2015 zum „Bürgerfest zjm Tag der Deutschen Einheit“ im Muldeparadies Zwickau